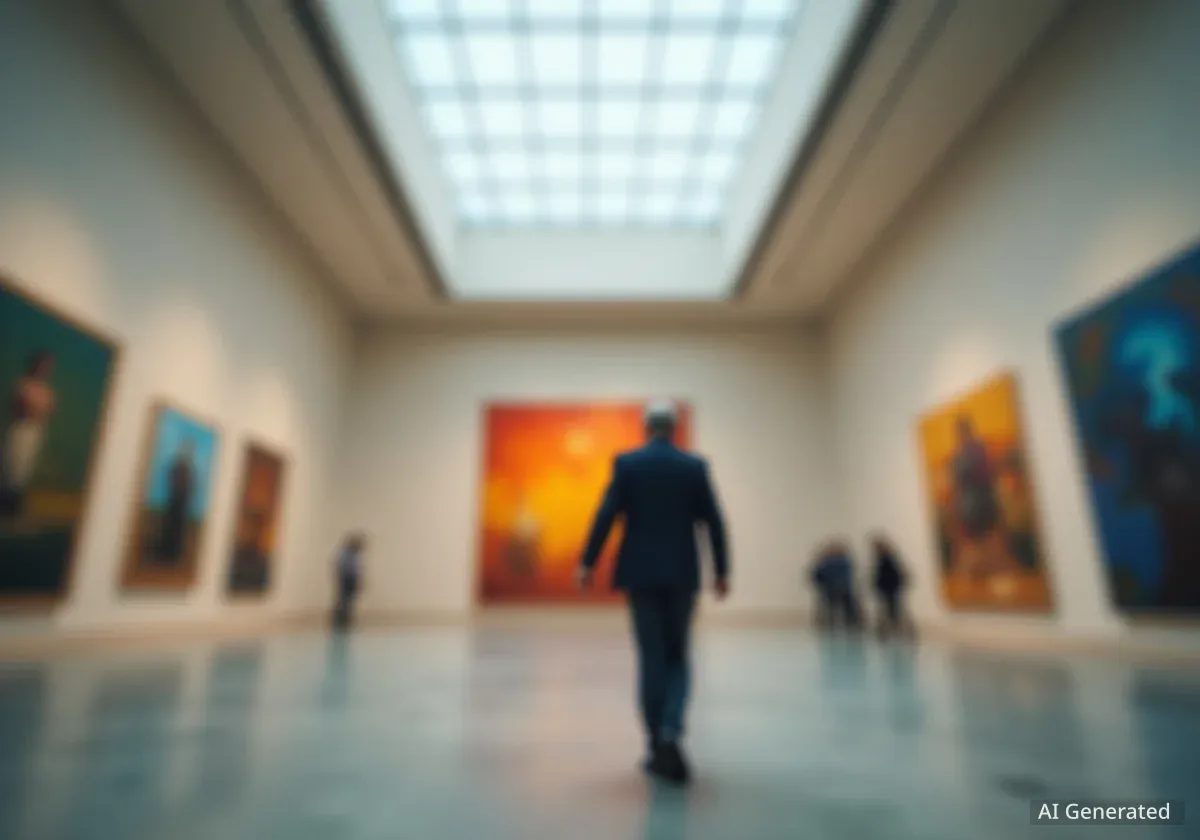Das Kunstmuseum Winterthur bietet einen schweizweit einzigartigen Workshop namens «Moving Art» an. Dieser innovative Ansatz ermöglicht es den Teilnehmenden, Kunstwerke durch körperliche Bewegung neu zu erfahren. Statt üblicher Betrachtungsmethoden konzentriert sich der Workshop auf eine unmittelbare, emotionale Interaktion mit den Gemälden.
Wichtige Erkenntnisse
- Der «Moving Art»-Workshop in Winterthur ist schweizweit einzigartig.
- Teilnehmende verbringen 15 Minuten vor einem Kunstwerk und spiegeln es mit Bewegungen wider.
- Die Methode wurde von Corinne Goetschel entwickelt und basiert auf Tanztechniken von Anna Halprin.
- Ziel ist eine tiefere, körperliche und emotionale Wahrnehmung von Kunst.
- Besucher verbringen durchschnittlich nur acht Sekunden vor einem Kunstwerk.
Einzigartiger Ansatz im Kunstmuseum Winterthur
Das Kunstmuseum Winterthur hat mit dem «Moving Art»-Workshop ein neues Format der Kunstvermittlung etabliert. Es ist das einzige Museum in der Schweiz, das diesen Ansatz anbietet. Im Gegensatz zu traditionellen Museumsbesuchen, bei denen Besucher oft schnell durch die Räume gehen, fordert der Workshop eine intensive Auseinandersetzung mit einem einzelnen Kunstwerk. Die Teilnehmenden stellen sich fünfzehn Minuten lang vor ein Gemälde und drücken ihre Wahrnehmung durch Bewegungen aus.
Für die Teilnahme sind keine besonderen Vorkenntnisse erforderlich. Lediglich die Freude an Bewegung wird vorausgesetzt. Die Leiterin des Workshops, Corinne Goetschel, betont, dass es darum geht, die Kunst mit dem Körper zu erforschen, nicht mit der Sprache. Normalerweise werden Kunstwerke in Museen ausführlich erklärt. Beim «Moving Art»-Workshop steht jedoch die unmittelbare, körperliche Reaktion im Vordergrund.
«Für einmal erforscht man Kunst nur mit dem Körper und nicht mit der Sprache», erklärt Corinne Goetschel, die den Workshop leitet und den neuartigen Ansatz entwickelt hat. «Wenn man auf die Kunstwerke aber nur mit dem Körper reagiert, erfasst man es anders, viel unmittelbarer und emotionaler.»
Inspiration durch «Slow Looking» und Anna Halprin
Goetschels Methode integriert Elemente aus verschiedenen Quellen. Eine davon ist die international verbreitete «Slow Looking»-Methode. Das Londoner Tate Modern hat festgestellt, dass Besucher ein Kunstwerk durchschnittlich nur acht Sekunden lang betrachten. «Slow Looking» zielt darauf ab, diese Verweildauer zu verlängern, um mehr Details zu entdecken und eine Entschleunigung im Alltag zu ermöglichen. Dies führt zu einer intensiveren Auseinandersetzung mit der Kunst.
Faktencheck
- Durchschnittliche Betrachtungszeit eines Kunstwerks: 8 Sekunden (Tate Modern).
- Der «Moving Art»-Workshop verlängert diese Zeit auf 15 Minuten pro Werk.
Ein noch grösserer Einfluss für «Moving Art» ist die Arbeit der amerikanischen Tanzpionierin Anna Halprin. Ende der 1970er-Jahre gründete Halprin das Tamalpa Institute. Diese Ausbildungsstätte besuchte auch Corinne Goetschel. Dort lernte sie, wie man schnelle Skizzen in Bewegungen übersetzt. Dieses Erlebnis war für Goetschel prägend und inspirierte sie zur Entwicklung des «Moving Art»-Konzepts.
Goetschel erinnert sich an den Moment am Tamalpa Institute, als sie eine Skizze in Bewegung umsetzen sollte. Sie empfand dies als so bereichernd, dass sie die Idee entwickelte, diese Technik auf Meisterwerke der Kunst anzuwenden. Seit 2022 bietet Corinne Goetschel ihren Workshop im Kunstmuseum Winterthur an. Sie lobt den Mut des Museums, neue Wege in der Kunstvermittlung zu gehen.
Der Workshop: Eine persönliche Erfahrung
Die Teilnahme am Workshop beginnt oft mit einer Aufwärmübung, die das Eis bricht. Eine Autorin, die den Workshop ausprobiert hat, berichtete von ihrer anfänglichen Scheu, sich frei zu bewegen. Doch eine Übung, bei der jeder seinen Namen nennen und eine passende Bewegung ausführen sollte, half, die Hemmungen abzubauen. Goetschel verspricht, dass man sich danach weniger exponiert fühlt.
Während des Workshops tragen die Teilnehmenden Kopfhörer. Über diese wird Musik – Klassik, Weltmusik, Jazz – eingespielt und Goetschel gibt Anweisungen. Dies schirmt die Teilnehmer von der Aussenwelt ab und ermöglicht es ihnen, sich ganz auf das Kunstwerk zu konzentrieren. Gelegentlich nehmen andere Museumsbesucher die Gruppe wahr, oft mit einer Mischung aus Neugier und Respekt.
Hintergrundinformationen
Das Kunstmuseum Winterthur ist bekannt für seine Sammlung moderner Kunst. Es zeigt Werke vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Mit der Einführung des «Moving Art»-Workshops erweitert es sein Angebot um eine innovative, partizipative Form der Kunstvermittlung, die Besucher auf einer neuen Ebene anspricht.
Die Transformation der Wahrnehmung
Nach einigen Aufwärmübungen wählen die Teilnehmenden ein Gemälde aus, das sie anspricht. Die Autorin entschied sich für ein Stillleben von Giovanni Giacometti, das drei Äpfel auf einem weissen Tischtuch zeigt. Ein Werk, das sie bei einem normalen Museumsbesuch möglicherweise übersehen hätte. Goetschels Anleitungen laden dazu ein, Formen im Gemälde zuerst mit den Augen, dann mit der Nase und schliesslich mit dem gesamten Kopf zu verfolgen.
Die Autorin wählte eine Falte im Tischtuch als erste Form und einen Apfel als zweite, dessen Umriss sie mit Schulterbewegungen spiegelte. Im letzten Schritt wurden diese Bewegungen zu einem zusammenhängenden Ablauf verbunden. Obwohl die anfängliche Umsetzung der Anweisungen herausfordernd war, stellte sich bald ein neues Gefühl ein. Bisher unbemerkte Bewegungen von Formen und Pinselstrichen rückten in den Mittelpunkt der Wahrnehmung. Details wurden deutlicher, und die Fantasie wurde angeregt.
Die grauen Pinselstriche in Giacomettis Stillleben erinnerten die Autorin plötzlich an eine Reihe von Frauen, die zum rechten Bildrand fliegen. Diese Art der Betrachtung führte zu einer tiefgreifenden Veränderung in der Wahrnehmung des Kunstwerks. Das Bedürfnis, bei anderen Teilnehmenden zu «spicken», kam erst auf, als Goetschel zum Abschied vom Bild aufforderte. Die anderen Teilnehmenden tanzten, verbogen sich und malten mit den Armen in die Luft, was die Vielfalt der individuellen Interpretationen zeigte.
- Erste Phase: Auswahl eines Kunstwerks, das anspricht.
- Zweite Phase: Erkundung von Formen und Linien mit Augen, Nase und Kopf.
- Dritte Phase: Spiegelung von Umrissen mit Körperbewegungen, zum Beispiel den Schultern.
- Vierte Phase: Aneinanderreihung der Bewegungen zu einem zusammenhängenden Ablauf.
Austausch und Vertiefung der Erfahrung
Am Ende des Workshops versammelten sich die Teilnehmenden im Kreis, legten die Kopfhörer ab und tauschten sich über ihre Erfahrungen aus. Wörter wie «tiefgehend», «inspirierend», «intensiv» und «emotional» fielen häufig. Sowohl erfahrene als auch neue Teilnehmer zeigten sich begeistert von der Wirkung des Workshops. Dies unterstreicht die Wirksamkeit des körperbasierten Ansatzes.
Im Verlauf des Workshops werden noch zwei weitere Gemälde ausgewählt. Beim letzten Bild gibt Goetschel keine spezifischen Anweisungen mehr. Den Teilnehmenden wird freigestellt, ob sie Musik hören möchten. Goetschel ist überzeugt, dass die Gemälde selbst «Partitur genug» sind. Die Autorin bemerkte, wie sie im Laufe der Zeit mutiger wurde. Sie tanzte einen schrägen Baum nach und wackelte mit den Fingern, um das Licht darzustellen, das durch das Blätterdach fiel.
Zum Abschluss des Workshops konnten die Teilnehmenden einander zeigen oder erzählen, wie sie mit ihrem liebsten Bild in Kontakt getreten waren. Eine Teilnehmerin zeigte eine Performance, die an professionellen Modern Dance erinnerte. Dies verdeutlichte das breite Spektrum der Ausdrucksformen, die durch den Workshop gefördert werden.
Der nächste «Moving Art»-Workshop findet am 9. November im Kunstmuseum beim Stadthaus statt. Interessierte haben somit die Möglichkeit, diese einzigartige Form der Kunstvermittlung selbst zu erleben und ihre Wahrnehmung von Kunst auf eine neue, tiefere Ebene zu heben.