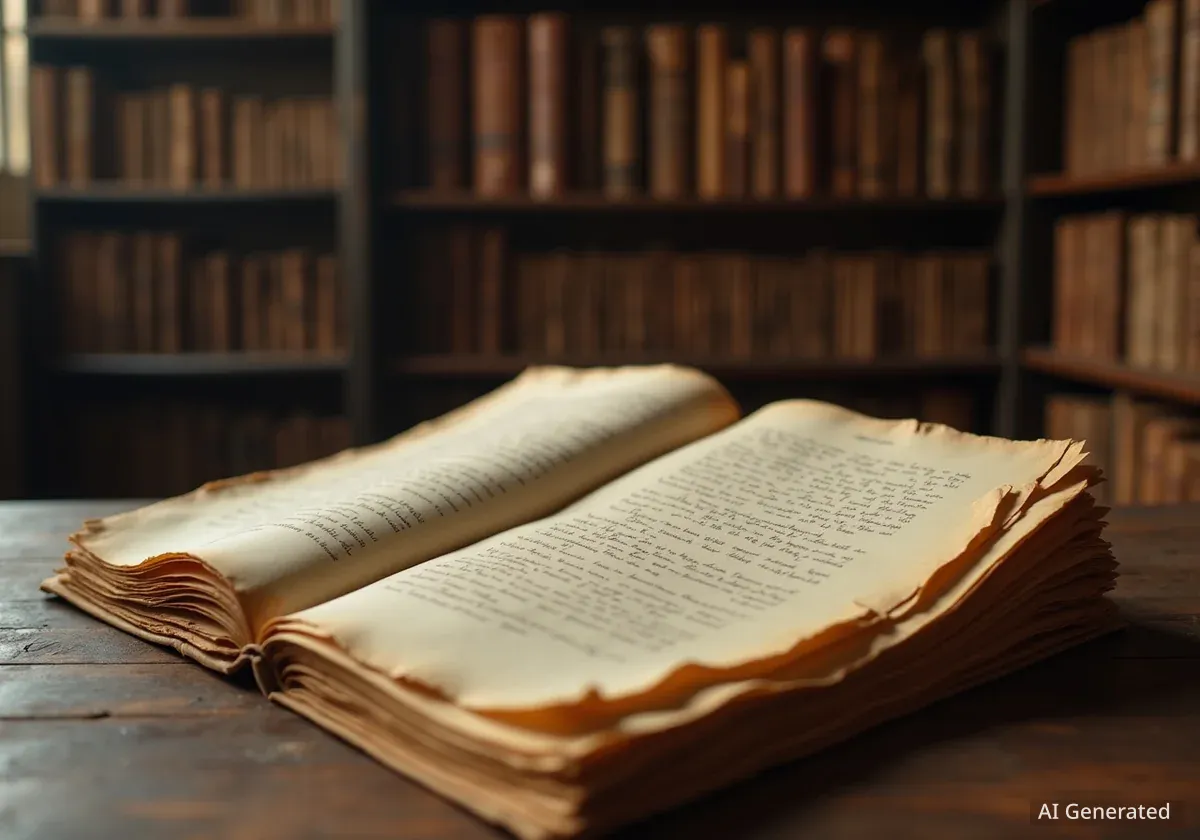Ein bedeutender Schatz der Zürcher und europäischen Geschichte ist nun für die Öffentlichkeit zugänglich. Nach einem fünfjährigen Grossprojekt hat die Universität Zürich die gesamte Korrespondenz des Reformators Heinrich Bullinger digitalisiert. Rund 12'000 Briefe aus dem 16. Jahrhundert können ab sofort online durchsucht werden und geben Einblicke in eine Zeit des Umbruchs.
Das Wichtigste in Kürze
- Die gesamte Korrespondenz von Heinrich Bullinger mit rund 12'000 Briefen wurde digitalisiert.
- Das Projekt «Bullinger Digital» der Universität Zürich dauerte fünf Jahre und nutzte künstliche Intelligenz.
- Die Briefe geben detaillierte Einblicke in Politik, Gesellschaft und Alltag während der Reformation.
- Das Staatsarchiv Zürich sichert den langfristigen Betrieb der Online-Plattform.
Ein Fenster ins 16. Jahrhundert
Heinrich Bullinger (1504–1575), der Nachfolger von Huldrych Zwingli am Zürcher Grossmünster, war eine zentrale Figur der europäischen Reformation. Über 52 Jahre hinweg pflegte er einen intensiven Austausch mit rund tausend Personen. Zu seinen Korrespondenten zählten Theologen, Fürsten, Gelehrte und Politiker in der ganzen Schweiz und Europa.
Bullinger erkannte früh den Wert dieser Dokumente. Er fertigte Kopien wichtiger Schreiben an und bemühte sich, Briefe aus den Nachlässen seiner Korrespondenten zurückzuerhalten. So entstand eine Sammlung, die heute als der umfangreichste erhaltene Gelehrtenbriefwechsel aus der Schweiz im 16. Jahrhundert gilt.
Bullingers Korrespondenz in Zahlen
- 12'000 Briefe sind erhalten.
- Rund 2'000 davon hat Bullinger selbst verfasst.
- Etwa 10'000 Briefe wurden an ihn gesendet.
- Schätzungen gehen davon aus, dass der Gesamtumfang ursprünglich bei über 20'000 Briefen lag.
«Man kann gar nicht abschliessend erfassen, was in den Bullingerbriefen alles verborgen ist», erklärt Patricia Scheurer, Co-Leiterin des Projekts «Bullinger Digital 2.0». Die Themen reichen von theologischen Debatten über das Abendmahl bis hin zu alltäglichen Sorgen wie der Pest und politischen Fragen des Widerstandsrechts.
Das Mammutprojekt «Bullinger Digital»
Die wissenschaftliche Aufarbeitung der Briefe begann bereits in den 1970er-Jahren am Institut für Schweizerische Reformationsgeschichte der Universität Zürich (UZH). Als die Finanzierung durch den Schweizerischen Nationalfonds auslief, entstand die Idee, das gesamte Erbe digital zugänglich zu machen.
Unter der Leitung des Instituts für Computerlinguistik der UZH arbeitete ein interdisziplinäres Team fünf Jahre lang an diesem Ziel. Über die UZH Foundation konnten mehr als 1,4 Millionen Schweizer Franken an privaten Spenden für das Projekt gesammelt werden. Die Zukunft der Plattform ist ebenfalls gesichert: Das Staatsarchiv Zürich, das bereits 11'000 der originalen Briefe seit seiner Gründung 1837 verwahrt, wird die digitale Edition pflegen und weiterentwickeln.
Technologie als Schlüssel zur Vergangenheit
Die Digitalisierung stellte das Team vor grosse Herausforderungen. Für die automatische Transkription von rund 3'000 noch nicht manuell erfassten Briefen musste eine künstliche Intelligenz (KI) auf rund 1'000 verschiedene Handschriften trainiert werden. «Nicht alle Briefe waren so schön geschrieben wie jene von Bullinger, manche waren sogar dermassen unleserlich, dass sie schon damals den Missmut des Empfängers hervorriefen», so Scheurer.
Eine weitere Hürde war der häufige Sprachwechsel zwischen Latein und Frühneuhochdeutsch. Hier zeigte sich der rasante Fortschritt der KI. Ein ursprünglich selbst entwickeltes Übersetzungssystem wurde bald von kommerziellen Werkzeugen überholt.
«Die Qualität von ChatGPT-Übersetzungen war von Anfang an erstaunlich gut», erinnert sich Patricia Scheurer. Das Projektteam entschied sich daher, auf diese externen Tools zu setzen, die Nutzer heute einfach selbst anwenden können.
Mensch und Maschine arbeiten zusammen
Auch die Identifikation von Personen und Orten in den Texten war komplex. Im 16. Jahrhundert wurden Namen oft latinisiert – aus einem «Brunner» wurde ein «Fontanus». Zudem erhielten Söhne häufig den Vornamen des Vaters, was die Zuordnung erschwert.
Hier kam die sogenannte «Citizen Science» ins Spiel. Freiwillige, meist historisch interessierte Laien, überprüften und korrigierten die maschinell erzeugten Namenszuweisungen. Diese Arbeit war entscheidend, um die Briefe nicht nur nach Namen, sondern gezielt nach Personen durchsuchbar zu machen.
Parallelen zur Gegenwart
Die Arbeit am Projekt fiel teilweise in die Zeit der Covid-19-Pandemie. Für die Forschenden ergaben sich dabei eindrückliche Parallelen. «Wir bauten während der Covid-19-Pandemie die Datenbank auf und lasen in Bullingers Briefen immer wieder von der Pest», erzählt Patricia Scheurer. «Wenn man dann während des Lockdowns durch die menschenleeren Gassen des Niederdorfs nach Hause ging, war das schon sehr eindrücklich.»
Ein Vermächtnis für die Zukunft
Das Projekt wurde vom plötzlichen Tod des Co-Leiters, Professor Martin Volk, im September 2025 überschattet. Sein Engagement war massgeblich für den Erfolg der Digitalisierung. Sein Werk lebt in diesem nun öffentlich zugänglichen Archiv weiter.
Wer mehr über die technischen Aspekte erfahren möchte, kann die aktuelle Ausstellung «Museum of the Future – 17 digitale Experimente» im Museum für Gestaltung in Zürich besuchen. Dort wird anschaulich erklärt, welche Rolle maschinelles Lernen bei der Transkription und Erschliessung der Bullingerbriefe spielte. Die Ausstellung läuft noch bis zum 1. Februar 2026.
Mit dem Abschluss von «Bullinger Digital» ist ein Kulturerbe von unschätzbarem Wert nicht nur für die Forschung, sondern für alle historisch Interessierten gesichert und einfacher zugänglich als je zuvor.