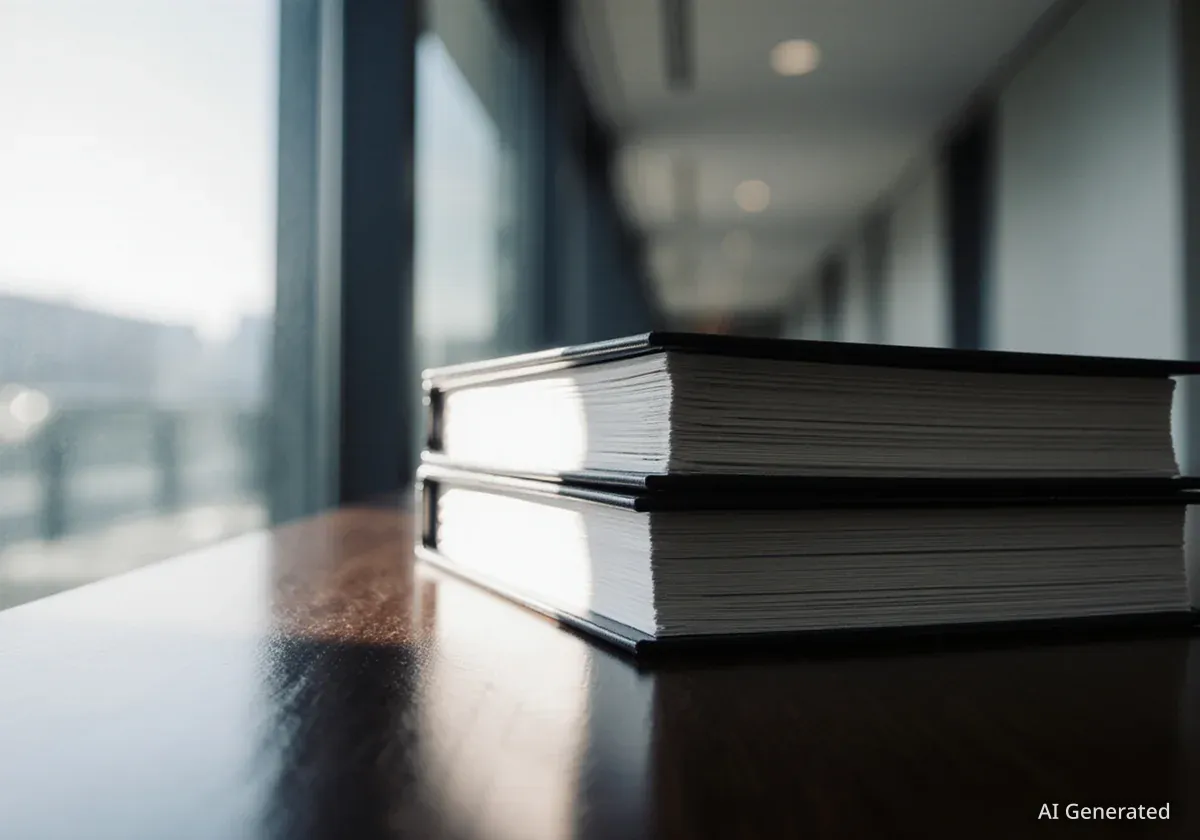Ein Filialleiter eines grossen Schweizer Detailhändlers im Bezirk Pfäffikon wurde verurteilt, nachdem Mitarbeitende eine als Kugelschreiber getarnte Kamera in einem Pausenraum entdeckt hatten. Solche verdeckten Aufnahmegeräte sind in der Schweiz grundsätzlich verboten, unabhängig von ihrer tatsächlichen Nutzung.
Der Vorfall führte zu einer bedingten Geldstrafe sowie einer Busse für den 32-jährigen Mann. Die Entdeckung der Kamera löste Fragen zum Datenschutz am Arbeitsplatz aus und verdeutlichte die rechtlichen Bestimmungen im Umgang mit Überwachungstechnologien.
Wichtige Fakten
- Ein Filialleiter im Bezirk Pfäffikon brachte eine als Kugelschreiber getarnte Minikamera an seinen Arbeitsplatz.
- Mitarbeitende entdeckten das Gerät im Pausenraum einer Detailhandelsfiliale.
- Verdeckte Aufnahmegeräte sind in der Schweiz illegal, selbst wenn sie nicht benutzt werden.
- Der Chef erhielt eine bedingte Geldstrafe von 20 Tagessätzen à 130 Franken und eine Busse von 500 Franken.
- Die Verfahrenskosten von 500 Franken muss er ebenfalls tragen.
Entdeckung der Kamera im Pausenraum
Der Vorfall ereignete sich in einer Filiale eines grossen Schweizer Detailhändlers im Bezirk Pfäffikon. Der damals 32-jährige Filialleiter hatte eine Minikamera, die in einem Kugelschreiber verborgen war, mit zur Arbeit gebracht. Mitarbeitende fanden das ungewöhnliche Gerät im Pausenraum. Diese Entdeckung führte zu einer sofortigen Untersuchung und später zu einer gerichtlichen Verurteilung des Filialleiters.
Solche getarnten Geräte sind leicht im Internet erhältlich. Sie werden oft als unauffällige Werkzeuge für verdeckte Aufnahmen beworben. Die Schweizer Gesetzgebung verbietet jedoch den Besitz und das Inverkehrbringen solcher Geräte, da sie primär der illegalen Überwachung dienen.
Faktencheck: Minikameras
Minikameras sind oft in Alltagsgegenstände wie Stifte, Krawatten, Knöpfe, Brillen oder sogar Linsen integriert. Sie ermöglichen unbemerkte Videoaufnahmen durch das Einsetzen einer Micro-SD-Karte und einen einfachen Knopfdruck. Die Verfügbarkeit im Internet täuscht oft über ihre Illegalität in der Schweiz hinweg.
Rechtliche Konsequenzen in der Schweiz
Der Strafbefehl beschreibt den Zweck des Geräts klar: «Mit dieser als Gebrauchsgegenstand getarnten Kamera konnte man nach dem Einsetzen einer Micro-SD-Karte mittels Knopfdruck unbemerkt Videoaufnahmen machen.» Es konnte jedoch nicht nachgewiesen werden, ob der Mann tatsächlich Aufnahmen angefertigt hatte. Dies war für die Verurteilung jedoch nicht entscheidend.
Die Schweizer Gesetzgebung ist in Bezug auf solche Geräte eindeutig. Geräte, die «aufgrund der Tarnung vor allem illegalen Aufnahmen» dienen, sind in der Schweiz nicht erlaubt. Dies gilt unabhängig davon, ob sie tatsächlich benutzt werden oder nicht. Der blosse Besitz und das Bereitstellen solcher Geräte am Arbeitsplatz sind strafbar.
«Die Geräte sind in der Schweiz überhaupt nicht erlaubt – unabhängig davon, ob man sie benutzt.»
Diese rechtliche Bestimmung soll den Schutz der Privatsphäre gewährleisten und den Missbrauch von Überwachungstechnologien verhindern. Der Gesetzgeber legt Wert darauf, dass die Möglichkeit zu illegalen Aufnahmen durch getarnte Geräte unterbunden wird, selbst wenn keine konkrete Tat nachweisbar ist.
Urteil und Strafmass
Der Filialleiter wurde wegen «Inverkehrbringens oder Anpreisens von Abhör-, Ton- und Bildaufnahmegeräten» verurteilt. Das Gericht verhängte eine bedingte Geldstrafe von 20 Tagessätzen. Jeder Tagessatz wurde auf 130 Franken festgelegt, basierend auf dem Einkommen des Mannes. Die Gesamtgeldstrafe beläuft sich somit auf 2600 Franken, die bei guter Führung nicht bezahlt werden muss.
Zusätzlich zur bedingten Geldstrafe wurde eine Busse von 500 Franken ausgesprochen. Der Verurteilte muss zudem die Verfahrenskosten in Höhe von weiteren 500 Franken übernehmen. Insgesamt belaufen sich die finanziellen Belastungen für den Mann auf 1000 Franken plus die bedingte Geldstrafe.
Hintergrund: Datenschutz am Arbeitsplatz
Der Datenschutz am Arbeitsplatz ist in der Schweiz durch verschiedene Gesetze geregelt, insbesondere durch das Datenschutzgesetz (DSG) und arbeitsrechtliche Bestimmungen. Arbeitgeber dürfen Mitarbeitende grundsätzlich nicht heimlich überwachen. Der Einsatz von Überwachungsgeräten ist nur unter strengen Voraussetzungen und meist nur nach vorheriger Information der Belegschaft zulässig, etwa zur Aufklärung von Straftaten oder zum Schutz von Eigentum. Das heimliche Anfertigen von Aufnahmen ist dabei fast immer illegal.
Vernichtung der Beweismittel
Ein wichtiger Bestandteil des Urteils ist die Vernichtung der sichergestellten Geräte und Daten. Der Kugelschreiber mit der eingebauten Kamera, die verwendeten Speicherkarten und alle darauf befindlichen Datensicherungen werden gemäss Gerichtsbeschluss vernichtet. Diese Massnahme dient dazu, jeglichen weiteren Missbrauch der Geräte zu verhindern und die potenziell erfassten Daten unwiderruflich zu löschen.
Dieser Fall unterstreicht die Bedeutung des Datenschutzes und der Privatsphäre am Arbeitsplatz. Er sendet ein klares Signal, dass der Einsatz von verdeckten Überwachungsgeräten in der Schweiz ernsthafte rechtliche Konsequenzen nach sich zieht.
Prävention und Sensibilisierung
Unternehmen sind angehalten, ihre Mitarbeitenden regelmässig über die Richtlinien zum Datenschutz und den Umgang mit Überwachungstechnologien zu informieren. Eine offene Kommunikation über die zulässigen und unzulässigen Praktiken kann dazu beitragen, ähnliche Vorfälle in der Zukunft zu vermeiden. Mitarbeitende sollten zudem ermutigt werden, verdächtige Beobachtungen oder Geräte den zuständigen Stellen zu melden.
- Information: Regelmässige Schulungen zum Datenschutz für alle Mitarbeitenden.
- Klare Richtlinien: Eindeutige Unternehmensrichtlinien zum Einsatz von Aufnahmegeräten am Arbeitsplatz.
- Meldestellen: Schaffung von vertraulichen Meldestellen für Mitarbeitende bei Verdachtsfällen.
- Rechtliche Konsequenzen: Aufklärung über die rechtlichen Folgen bei Verstössen gegen den Datenschutz.
Die Digitalisierung bringt viele Vorteile, aber auch neue Herausforderungen im Bereich der Privatsphäre mit sich. Die ständige Verfügbarkeit von Überwachungstechnologien erfordert eine erhöhte Wachsamkeit und klare gesetzliche Rahmenbedingungen, um die Rechte der Einzelnen zu schützen.
Dieser Fall aus dem Bezirk Pfäffikon dient als Mahnung, dass die scheinbar harmlosen Gadgets, die im Internet bestellt werden können, ernste juristische und ethische Fragen aufwerfen, wenn sie im Arbeitsumfeld eingesetzt werden.