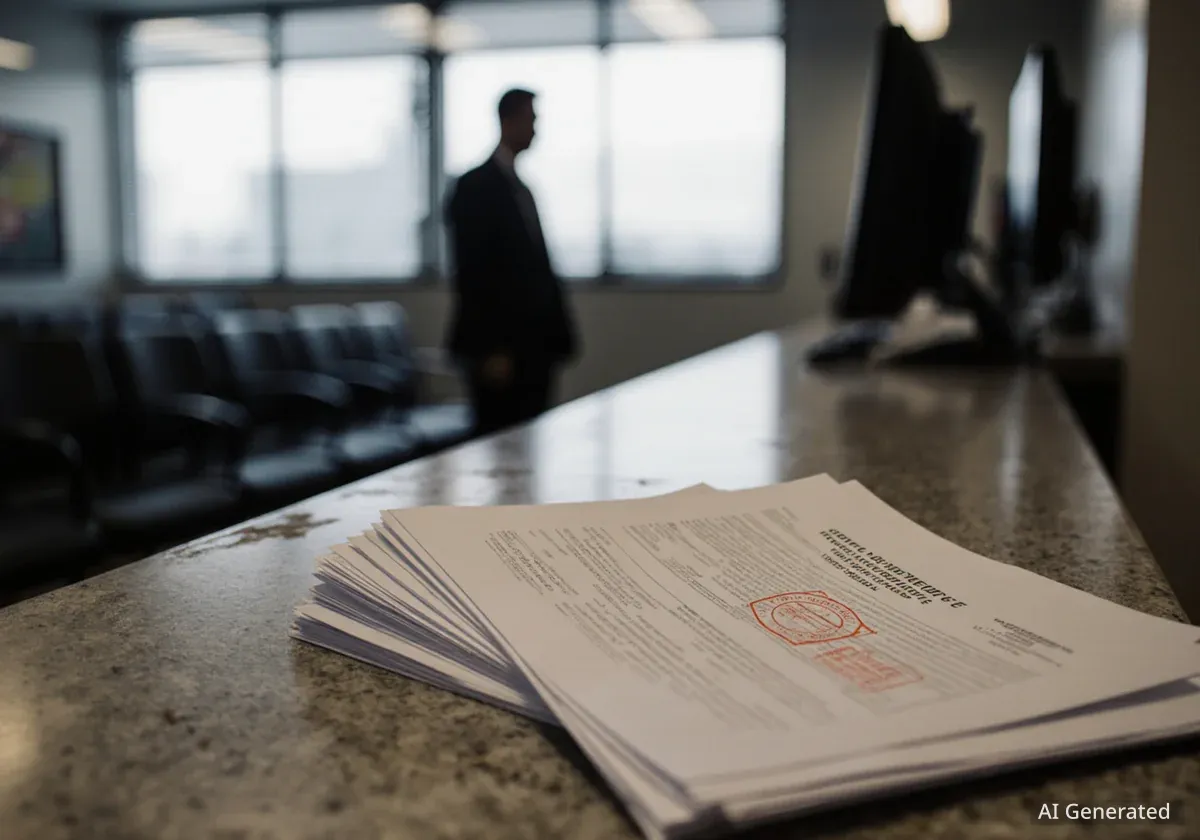Die fortschreitende Entwicklung von generativer Künstlicher Intelligenz (KI) beeinflusst die Arbeitsweise in Nachrichtenredaktionen weltweit. Eine neue Studie des Forschungszentrums Öffentlichkeit und Gesellschaft (fög) der Universität Zürich (UZH) hat erstmals umfassend den Einsatz und die Auswirkungen von KI im Schweizer Journalismus analysiert. Die Ergebnisse basieren auf einer Onlinebefragung von 730 Medienschaffenden aus allen drei grossen Sprachregionen der Schweiz.
Die Untersuchung zeigt, dass KI-Tools in Redaktionen weit verbreitet sind. Ein Grossteil der Medienschaffenden nutzt KI im Arbeitsalltag, während ein kleinerer Teil noch zurückhaltend ist. Die Studie beleuchtet auch die unterschiedlichen Einschätzungen zur Qualität, Ethik und den Auswirkungen auf die Medienbranche.
Wichtige Erkenntnisse
- 87% der Medienschaffenden nutzen KI-Tools im Arbeitsalltag.
- 63% schätzen KI als nützlich für die eigene Arbeit ein.
- KI wird hauptsächlich für unterstützende Aufgaben wie Transkriptionen oder Textoptimierungen verwendet.
- 15% der Befragten berichten von Fehlern durch KI-Einsatz.
- 80% sehen viele ethische Fragen im Zusammenhang mit KI im Journalismus.
- Eine Mehrheit befürchtet eine Zunahme von Falschinformationen (61%) und eine Gefährdung des Publikumsvertrauens (70%).
KI-Nutzung in Schweizer Redaktionen
Die Studie des fög zeigt, dass Künstliche Intelligenz in Schweizer Redaktionen bereits fest etabliert ist. Insgesamt 87 Prozent der befragten Medienschaffenden geben an, KI-Tools in ihrem Arbeitsalltag zu nutzen. Davon verwenden 17 Prozent diese sogar sehr intensiv. Dies unterstreicht die schnelle Integration neuer Technologien in den journalistischen Prozess.
Es gibt jedoch auch einen Teil der Befragten, der KI-Tools weniger oder gar nicht einsetzt. Rund 13 Prozent nutzen KI nie, weitere 18 Prozent nur selten. Diese Zahlen deuten auf eine heterogene Akzeptanz innerhalb der Branche hin. Jüngere Medienschaffende und Mitarbeitende in grösseren Redaktionen greifen häufiger auf KI zurück. Dies könnte auf eine höhere Affinität zu neuen Technologien und bessere Ressourcen in grossen Häusern hindeuten.
Faktencheck: Wer nutzt KI?
- Jüngere Medienschaffende nutzen KI häufiger.
- Mitarbeitende grösserer Redaktionen setzen KI öfter ein.
- Ältere Kolleg:innen und kleine Redaktionen sind zurückhaltender.
Nützlichkeit und Anwendungsbereiche
Fast zwei Drittel der Schweizer Journalist:innen, genauer 63 Prozent, bewerten KI als nützlich für ihre Arbeit. Dies zeigt eine prinzipiell positive Einstellung gegenüber der Technologie. Die Anwendungsbereiche sind dabei klar definiert. KI-Tools werden vor allem unterstützend eingesetzt.
«Dabei werden KI-Tools überwiegend unterstützend eingesetzt – zum Beispiel für Transkriptionen, Textoptimierungen oder Titelvorschläge», sagt Studienverantwortliche Silke Fürst.
Die Generierung ganzer Inhalte, seien es Texte, Bilder oder Videos, spielt laut der wissenschaftlichen Mitarbeiterin am fög kaum eine Rolle. Dies deutet darauf hin, dass KI derzeit eher als Hilfsmittel zur Effizienzsteigerung und weniger als Ersatz für menschliche Kreativität und Recherche gesehen wird.
Qualitätssicherung und Fehlerquellen
Die Meinungen zur Auswirkung von KI auf die Inhaltsqualität sind geteilt. Etwa ein Drittel der Befragten (33 Prozent) gibt an, dass sich die Qualität ihrer Beiträge durch den Einsatz von KI verbessert hat. Ein grösserer Anteil, nämlich 38 Prozent, stellt jedoch fest, dass dies kaum oder gar nicht der Fall ist. Diese unterschiedlichen Einschätzungen zeigen, dass die Vorteile nicht überall gleich wahrgenommen werden.
Ein weiteres kritisches Thema ist die Zeit für die Prüfung von KI-generierten Inhalten. 18 Prozent der Medienschaffenden räumen ein, nicht genügend Zeit zu haben, um diese Informationen sorgfältig zu prüfen. Zudem fehlt 24 Prozent die Zeit, um KI-generierte Inhalte durch eigene Quellen oder Auskunftspersonen zu ergänzen. Diese Ergebnisse werfen Fragen zur Sorgfaltspflicht und zur Sicherstellung der Genauigkeit auf.
Hintergrund: Qualität im Journalismus
Die Sicherstellung der journalistischen Qualität ist ein zentraler Pfeiler der Glaubwürdigkeit. Mit dem Einsatz von KI treten neue Herausforderungen auf, insbesondere im Hinblick auf die Verifizierung von Informationen. Eine unzureichende Prüfung kann das Risiko von Fehlern erhöhen und das Vertrauen des Publikums beeinträchtigen.
Fehler und fehlende Richtlinien
Die Mehrheit der Befragten berichtet, dass in ihrer Redaktion keine systematischen Massnahmen zur Qualitätssicherung beim KI-Einsatz existieren oder sie diese nicht kennen. Dies ist ein besorgniserregender Befund, da er auf einen Mangel an klaren Prozessen hindeutet. Konkrete Auswirkungen zeigen sich bereits: 15 Prozent der Befragten geben an, dass der redaktionelle Einsatz von KI bereits zu Fehlern geführt hat.
Diese Fehler können das Vertrauen der Leserschaft untergraben. Die Notwendigkeit klarer Richtlinien und Schulungen für den Umgang mit KI in Redaktionen wird dadurch deutlich. Ohne solche Massnahmen besteht die Gefahr, dass die Vorteile von KI durch eine nachlassende Qualität oder gar Falschinformationen zunichtegemacht werden.
Ethische Fragen und Branchenstandards
Der Einsatz von KI im Journalismus wirft viele ethische Fragen auf. Wenig überraschend sind vier von fünf Medienschaffenden, also 80 Prozent, dieser Meinung. Diese Erkenntnis bestätigt die Notwendigkeit, sich intensiv mit den moralischen und gesellschaftlichen Implikationen der Technologie auseinanderzusetzen.
In den letzten Jahren haben viele Medienhäuser und auch die Branche als Ganzes Richtlinien für den Umgang mit KI eingeführt. Fast die Hälfte der Befragten empfindet die Richtlinien des eigenen Medienhauses als hilfreich. Ein knappes Drittel kennt diese jedoch nicht. Branchenweite KI-Richtlinien werden von deutlich weniger Befragten als nützlich empfunden, und noch weniger kennen sie. Dies zeigt eine Diskrepanz zwischen der Existenz von Richtlinien und ihrer Bekanntheit sowie Akzeptanz.
Ethische Bedenken im Fokus
- 80% der Medienschaffenden sehen viele ethische Fragen.
- Redaktionelle Richtlinien sind nur für die Hälfte der Befragten hilfreich.
- Branchenweite Richtlinien sind weniger bekannt und werden seltener als nützlich empfunden.
Kennzeichnungspflicht und Publikumsvertrauen
Trotz der unterschiedlichen Kenntnis und Akzeptanz von Richtlinien gibt es einen breiten Konsens in einem wichtigen Punkt: Mehr als 80 Prozent der Medienschaffenden sind der Meinung, dass es branchenweite Standards zur Kennzeichnung von KI in der Medienberichterstattung braucht. Eine solche Kennzeichnung würde dem Publikum ermöglichen, den Einsatz von KI besser nachzuvollziehen. Dies ist entscheidend, um Transparenz zu schaffen und das Vertrauen der Leserschaft zu erhalten.
Die Forderung nach einer klaren Kennzeichnung unterstreicht das Bewusstsein der Journalist:innen für die Bedeutung von Transparenz in einer Zeit, in der die Grenzen zwischen menschlich erstellten und maschinengenerierten Inhalten zunehmend verschwimmen. Dies könnte ein wichtiger Schritt sein, um die Glaubwürdigkeit des Journalismus im digitalen Zeitalter zu sichern.
Auswirkungen auf die Medienbranche
Die Einschätzungen zu den Auswirkungen von KI auf die gesamte Medienbranche sind überwiegend skeptisch. Ähnlich wie in der Schweizer Bevölkerung überwiegen hier die Bedenken. Dies zeigt eine gewisse Unsicherheit und Besorgnis über die langfristigen Konsequenzen der Technologie.
«61% der Medienschaffenden gehen davon aus, dass der KI-Einsatz im Schweizer Journalismus die Verbreitung von Falschinformationen begünstigt, 68% erwarten die Angleichung von Inhalten und 70% befürchten, dass KI das Vertrauen des Publikums gefährden könnte», sagt Silke Fürst.
Diese Zahlen verdeutlichen die tiefgreifenden Sorgen, die in der Branche herrschen. Die Befürchtung einer Zunahme von Falschinformationen ist besonders relevant in einer Zeit, in der die Verbreitung von Desinformation bereits eine grosse Herausforderung darstellt. Eine Angleichung von Inhalten könnte zudem die Vielfalt und Einzigartigkeit der journalistischen Landschaft gefährden.
Abhängigkeit und Kooperationen
Viele Journalist:innen konstatieren zudem eine wachsende Abhängigkeit von Tech-Unternehmen, genauer 75 Prozent. Diese Abhängigkeit könnte die Autonomie der Medienhäuser einschränken und die Entwicklung des Journalismus in eine bestimmte Richtung lenken, die nicht immer im besten Interesse der Branche liegt. Die Sorge ist hier, dass die Machtverhältnisse sich zugunsten grosser Technologiekonzerne verschieben.
Als mögliche Lösung sprechen sich 46 Prozent der Befragten für Kooperationen zur Entwicklung eigener KI-Tools aus. Solche Kooperationen könnten mehrere Vorteile bieten. Sie könnten die Investitionskosten für einzelne Medienunternehmen reduzieren. Zudem könnten die Anforderungen von Schweizer Redaktionen besser berücksichtigt werden. Ein weiterer Vorteil wäre die Verringerung des Ungleichgewichts zwischen grossen und kleineren Redaktionen, indem auch kleinere Akteure Zugang zu fortschrittlichen KI-Lösungen erhalten.
Finanzierung und Partner der Studie
Die Studie wurde von der Digitalisierungsinitiative der Zürcher Hochschulen (DIZH) gefördert. Beteiligt waren Partner wie die Università della Svizzera italiana (USI), die Universität Freiburg, die Fachhochschule Graubünden und das IAM Institut für Angewandte Medienwissenschaft der ZHAW. Auch Organisationen wie Junge Journalistinnen und Journalisten Schweiz (JJS), Qualität im Journalismus (QuaJou) und das Schweizer Syndikat Medienschaffender (SSM) unterstützten das Projekt. Diese breite Unterstützung unterstreicht die Relevanz des Themas für die gesamte Schweizer Medienlandschaft.
Die vollständige Studie mit den detaillierten Einschätzungen Schweizer Medienschaffender zum Einsatz von KI im Journalismus ist auf der Website des fög (www.foeg.uzh.ch) verfügbar. Sie bietet eine fundierte Grundlage für weitere Diskussionen und die Entwicklung von Strategien zum verantwortungsvollen Umgang mit KI im Journalismus.