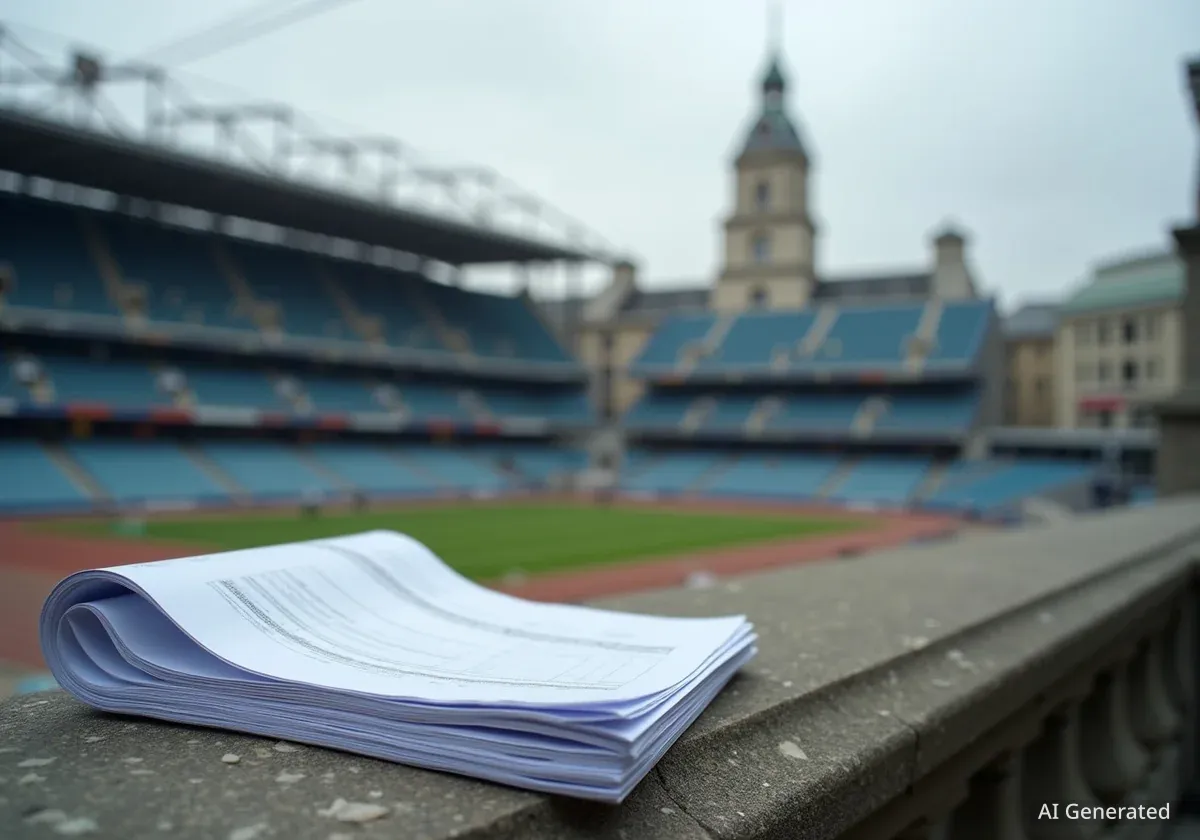Forschende der Empa untersuchen, wie Wasserstoff hochfeste Stähle versprödet. Diese Forschung ist entscheidend, um die Sicherheit von Bauwerken wie Brücken und Hochhäusern zu gewährleisten. Ziel ist es, die komplexen Mechanismen der Wasserstoffversprödung besser zu verstehen und widerstandsfähigere Materialien zu entwickeln.
Die Wasserstoffversprödung stellt eine erhebliche Gefahr für Stahlkonstruktionen dar. Sie kann zu plötzlichen Rissen und zum Versagen von Bauteilen führen. Das Forschungsteam konzentriert sich auf die Interaktion von Wasserstoff mit den schützenden Oxidschichten auf Stahl.
Wichtige Erkenntnisse
- Wasserstoff kann hochfeste Stähle verspröden und Bauwerke gefährden.
- Empa-Forschende untersuchen die Rolle der nativen Oxidschicht auf Stahl.
- Ein innovativer Versuchsaufbau ermöglicht die Isolierung von Wasserstoffeinflüssen.
- Harte Röntgenphotoelektronenspektroskopie (HAXPES) analysiert tieferliegende Schichten.
- Die Forschung zielt auf langlebigere Bauwerke und Infrastruktur für grünen Wasserstoff ab.
Die Gefahr der Wasserstoffversprödung
Der Einsturz eines Teils der Carolabrücke in Dresden am 11. September 2024 zeigte die zerstörerische Kraft der Wasserstoffversprödung. Risse in der stählernen Spannstruktur führten zum Versagen eines etwa 100 Meter langen Abschnitts. Dieses Ereignis unterstreicht die Notwendigkeit, die Mechanismen dieser Materialschädigung besser zu verstehen.
Die Carolabrücke ist kein Einzelfall. Auch bekannte Bauwerke wie der Londoner Wolkenkratzer «122 Leadenhall Street», bekannt als «Cheesegrater», und die Bay Bridge in San Francisco waren betroffen. Dort führten Versagen von Stahlbolzen zu Sanierungskosten in Millionenhöhe. Diese Vorfälle verdeutlichen das globale Ausmass des Problems.
Faktencheck
- Einsturz Carolabrücke: 11. September 2024, ca. 100 Meter.
- Ursache: Risse durch Wasserstoffversprödung.
- Weitere Fälle: «Cheesegrater» (London), Bay Bridge (San Francisco).
- Kosten: Millionenhöhe für Sanierungen.
Wie Wasserstoff Stahl angreift
Wasserstoffversprödung entsteht, wenn atomarer Wasserstoff in Stahl eindringt. Bestimmte Korrosionsprozesse, die in Anwesenheit von Wasser ablaufen, setzen diesen Wasserstoff an der Stahloberfläche frei. Als kleinstes Element des Periodensystems kann Wasserstoff leicht in das Material diffundieren.
Im Stahl begünstigt der Wasserstoff dann die Rissbildung durch verschiedene Mechanismen. Obwohl das Phänomen seit dem 19. Jahrhundert bekannt ist, sind die komplexen Prozesse dahinter noch nicht vollständig entschlüsselt. Zahlreiche Studien haben sich mit diesem Thema befasst, aber es bleiben offene Fragen.
«Wasserstoff sammelt sich im Material jeweils dort an, wo Unordnung herrscht», erklärt Doktorandin Chiara Menegus. «Die Grenzfläche zwischen dem Metall und dem Oxid ist eine solche Stelle.»
Die Rolle der nativen Oxidschicht
Forschende des Empa-Labors für Fügetechnologie und Korrosion konzentrieren sich auf einen bisher wenig beachteten Aspekt: die Interaktion von Wasserstoff mit der nativen Oxidschicht auf Stahl. Diese Schicht wird auch Passivierungsschicht genannt. Sie bildet sich auf natürliche Weise auf den meisten Metallen und Legierungen.
Die native Oxidschicht ist nur wenige Nanometer dick. Sie ist für die Korrosionsbeständigkeit von rostfreien Stählen entscheidend. Ihre genaue Art und Zusammensetzung variieren je nach Stahlsorte. Einige Oxide sind stabiler und widerstandsfähiger gegen Wasserstoff als andere. Diese schützen den Stahl besser vor Versprödung.
Chiara Menegus und Claudia Cancellieri, die Empa-Forscherinnen, untersuchen dies genauer. Sie legen besonderes Augenmerk auf die Grenzfläche zwischen dem Metall und seiner Oxidschicht. Dort, wo die Materialstruktur unregelmässig ist, kann sich Wasserstoff besonders gut ansammeln und Schäden verursachen.
Hintergrund: Native Oxidschicht
Die native Oxidschicht ist eine dünne, schützende Schicht, die sich spontan auf Metalloberflächen bildet. Sie verhindert, dass das darunterliegende Metall weiter korrodiert. Ihre Eigenschaften sind entscheidend für die Haltbarkeit von Stahlkonstruktionen.
Innovativer Versuchsaufbau in der Empa
Die Forschung an Wasserstoff im Stahl ist technisch anspruchsvoll. Das leichte Element Wasserstoff lässt sich mit herkömmlichen Analysemethoden nicht direkt nachweisen. Experimente müssen unter Ausschluss von Sauerstoff und Feuchtigkeit stattfinden. Andernfalls würden komplexe Korrosionsprozesse den Einfluss von Wasserstoff überlagern.
Eine weitere Herausforderung ist die Untersuchung der Grenzfläche zwischen Metall und Oxidschicht. «Es ist schwierig, eine verborgene Grenzfläche im Inneren des Materials zu untersuchen, ohne die Probe zu zerstören», erklärt Claudia Cancellieri, Forschungsgruppenleiterin im Labor für Fügetechnologie und Korrosion.
Spezielle elektrochemische Zelle
Die Forschenden haben diese Herausforderungen mit einem innovativen Versuchsaufbau gemeistert. Im ersten Jahr ihrer Doktorarbeit entwickelte Chiara Menegus eine spezielle elektrochemische Zelle. In dieser Zelle wird die Stahlprobe befestigt.
Auf einer Seite der Probe befindet sich Wasser, auf der anderen das inerte Edelgas Argon. Durch Anlegen einer elektrischen Spannung wird aus dem Wasser atomarer Wasserstoff erzeugt. Dieser Wasserstoff diffundiert durch die dünne Probe. Er erreicht dann die Oxidschicht auf der gegenüberliegenden Seite und interagiert dort mit dem nativen Oxid.
«So können wir die Interaktion von atomarem Wasserstoff mit dem nativen Oxid von anderen Umwelteinflüssen isolieren», erläutert Menegus. Alle Schritte, vom Zusammenbau der Zelle bis zur Analyse der Probe, finden unter Schutzatmosphäre in einer sogenannten Glovebox statt. Dies gewährleistet präzise und unverfälschte Ergebnisse.
Fortschrittliche Analysetechniken
Für die Charakterisierung der Proben nutzen die Empa-Forschenden eine in der Schweiz einzigartige Analysetechnik: die harte Röntgenphotoelektronenspektroskopie (HAXPES). Diese Methode verwendet hochenergetische Röntgenstrahlung.
HAXPES ermöglicht es, die Art und den chemischen Zustand von Atomen in einem Material zu bestimmen. Dies ist nicht nur an der Oberfläche möglich, sondern auch bis zu 20 Nanometer in der Tiefe. Diese Tiefe reicht aus, um die rund fünf Nanometer dicke Oxidschicht und die darunterliegende Grenzfläche zum Stahl zu erfassen.
Obwohl der Wasserstoff selbst nicht direkt erfasst werden kann, konnten die Forschenden seine Auswirkungen auf die gesamte Oxidschicht bereits deutlich zeigen. «Die ersten Versuche zeigen, dass der Wasserstoff die schützende Oxidschicht abbaut», sagt Menegus. Dies ist ein wichtiger Schritt zum Verständnis des Versprödungsprozesses.
Zukünftige Schritte und Auswirkungen
Nun will Chiara Menegus die Oxide auf verschiedenen Eisen-Chrom-Legierungen und gängigen Stählen untersuchen. Im Anschluss werden die Forschenden zusammen mit dem «Ion Beam Physics Lab» der ETH Zürich den Wasserstoffgehalt in den Proben direkt bestimmen. Dies wird in Echtzeit mit einer aufwendigen Teilchenbeschleuniger-Methode geschehen.
«Wir hoffen, dadurch den Effekt von Wasserstoff auf die nativen Oxidschichten besser zu verstehen und besonders resistente Oxidformen zu finden», fassen Menegus und Cancellieri zusammen. Ihre Forschungsergebnisse könnten weitreichende Auswirkungen haben.
Die Erkenntnisse könnten zum Bau von langlebigeren Brücken und anderen Infrastrukturen führen. Zudem könnten sie die Entwicklung besserer Methoden für die Lagerung und den Transport von grünem Wasserstoff unterstützen. Dies wäre ein wichtiger Beitrag zur Energiewende und zur Sicherheit kritischer Infrastrukturen.
HAXPES erklärt
- Name: Harte Röntgenphotoelektronenspektroskopie.
- Prinzip: Nutzt den photoelektrischen Effekt (Nobelpreis Albert Einstein, 1921).
- Funktion: Hochenergetische Röntgenstrahlung schlägt Elektronen aus dem Material.
- Ergebnis: Rückschlüsse auf chemische Beschaffenheit und atomare Zusammensetzung.
- Vorteil: Dringt tiefer ein als herkömmliche XPS (bis zu 20 nm).
- Anwendungen: Mikroelektronik, Batterien, Dünnschichten, Katalyse, Korrosionsforschung.
- Standort: Einzige Anlage in der Schweiz befindet sich im Empa-Labor.