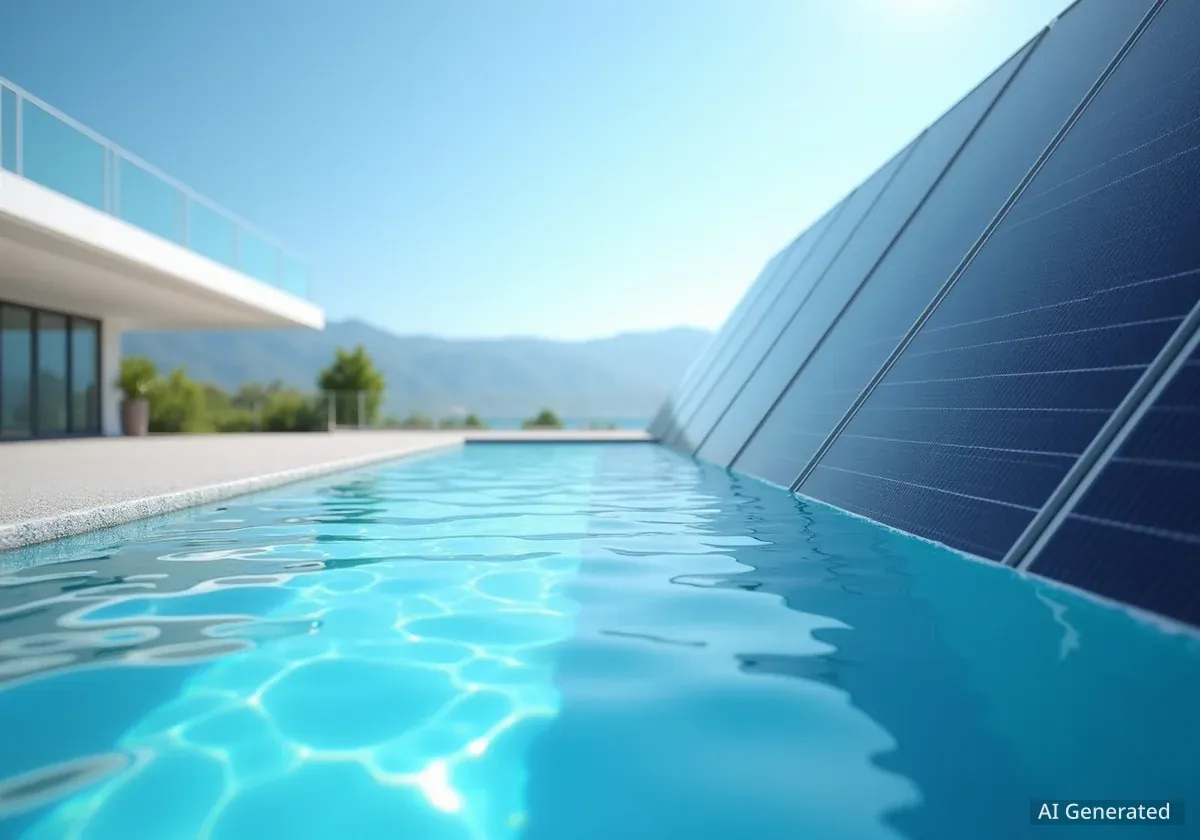In Flaach wird eine innovative Lösung für die lokale Energieversorgung umgesetzt. Die bei der Herstellung von Pflanzenkohle entstehende Abwärme der Firma Auen Pflege Dienst AG (APD) soll ab Anfang 2026 in das kommunale Wärmenetz eingespeist werden. Dieses Projekt verspricht, den Holzverbrauch der Gemeinde erheblich zu reduzieren und die Versorgungssicherheit zu erhöhen.
Das Wichtigste in Kürze
- Ab Januar 2026 wird die Abwärme der Firma APD in das Wärmenetz Flaach geleitet.
- Das Projekt soll jährlich rund 300 Tonnen Waldhackschnitzel einsparen.
- Eine neue, 400 Meter lange Verbindungsleitung wird derzeit gebaut, um die beiden Systeme zu koppeln.
- Die Versorgungssicherheit für 44 angeschlossene Kunden, darunter ein Alterswohnheim, wird verbessert.
Ein Kreislauf für lokale Energie
In einer Industriehalle in Flaach betreibt die Auen Pflege Dienst AG (APD) eine grosse Pyrolyseanlage. In diesem technischen Verfahren werden Holzschnitzel unter hohen Temperaturen zu Pflanzenkohle verarbeitet. Dieser Prozess erzeugt eine grosse Menge an Wärme, die bisher nur teilweise genutzt wurde, etwa zur Trocknung von Holz oder für ein kleines, separates Wärmenetz im Industriegebiet Botzen.
Diese ungenutzte Energiequelle soll nun der gesamten Gemeinde zugutekommen. In einer gemeinsamen Initiative haben der Wärmeverbund Flaach und die APD beschlossen, die Abwärme systematisch zu nutzen. Die Umsetzung ist bereits im Gange: Eine 400 Meter lange Verbindungsleitung wird aktuell zwischen der Produktionsstätte der APD und der Energiezentrale des Wärmeverbunds Flaach gebaut.
Was ist Pflanzenkohle?
Pflanzenkohle entsteht durch die sogenannte Pyrolyse, bei der Biomasse wie Holzschnitzel unter Sauerstoffausschluss stark erhitzt wird. Das Endprodukt ist ein poröser, kohlenstoffreicher Stoff. In der Landwirtschaft und im Gartenbau wird Pflanzenkohle zur Verbesserung der Bodenqualität eingesetzt, da sie Wasser und Nährstoffe speichern kann. Gleichzeitig bindet sie langfristig Kohlenstoff im Boden.
Massive Einsparungen bei Holzschnitzeln
Die Auswirkungen dieses Projekts auf die Energiebilanz von Flaach sind beträchtlich. Sobald die Verbindung Anfang 2026 in Betrieb geht, kann die überschüssige Abwärme der APD direkt in das bestehende Netz eingespeist, verteilt oder für später gespeichert werden. Berechnungen zeigen, dass dadurch mehr als 50 Prozent des bisherigen Holzbedarfs des Wärmeverbunds Flaach gedeckt werden können.
Diese Effizienzsteigerung hat direkte ökologische Vorteile. Jährlich können so rund 300 Tonnen Waldhackschnitzel eingespart werden. Das schont nicht nur die lokalen Wälder, sondern reduziert auch den logistischen Aufwand für den Transport des Brennmaterials.
Projekt im Überblick
- Partner: Auen Pflege Dienst AG (APD) und Wärmeverbund Flaach
- Technologie: Nutzung der Abwärme aus einer Pyrolyseanlage
- Infrastruktur: 400 Meter lange Verbindungsleitung
- Starttermin: Januar 2026
- Jährliche Einsparung: 300 Tonnen Holzschnitzel
Höhere Versorgungssicherheit für alle
Die neue Leitung ist keine Einbahnstrasse. Sie wurde so konzipiert, dass bei Bedarf auch Wärme vom Wärmeverbund Flaach zurück zur APD fliessen kann. Diese bidirektionale Funktion ist besonders wichtig bei Wartungsarbeiten an der Pyrolyseanlage oder bei kurzfristigen Lastspitzen im Netz.
Für die an das Wärmenetz angeschlossenen Betriebe im Industriegebiet erhöht sich dadurch die Versorgungssicherheit markant. Auch die 44 Kunden des Wärmeverbunds Flaach, zu denen unter anderem das Alterswohnheim Flaachtal gehört, profitieren von einem stabileren und nachhaltigeren System.
Modernisierung als Teil der Strategie
Parallel zum Bau der Verbindungsleitung modernisiert die APD ihre Produktionsanlagen. Die bestehende Pyrolyseanlage wird derzeit zurückgebaut und soll noch in diesem Herbst durch eine Anlage der neuesten Generation ersetzt werden. Diese Modernisierung ist ein entscheidender Schritt, um eine konstante und effiziente Wärmeproduktion für das gemeinsame Projekt sicherzustellen.
Das Projekt in Flaach zeigt beispielhaft, wie durch die intelligente Kopplung von industriellen Prozessen und kommunaler Infrastruktur lokale Energiekreisläufe geschlossen werden können. Statt wertvolle Wärme ungenutzt an die Umwelt abzugeben, wird sie zu einer wichtigen Ressource für die Beheizung von Wohn- und Geschäftsgebäuden.