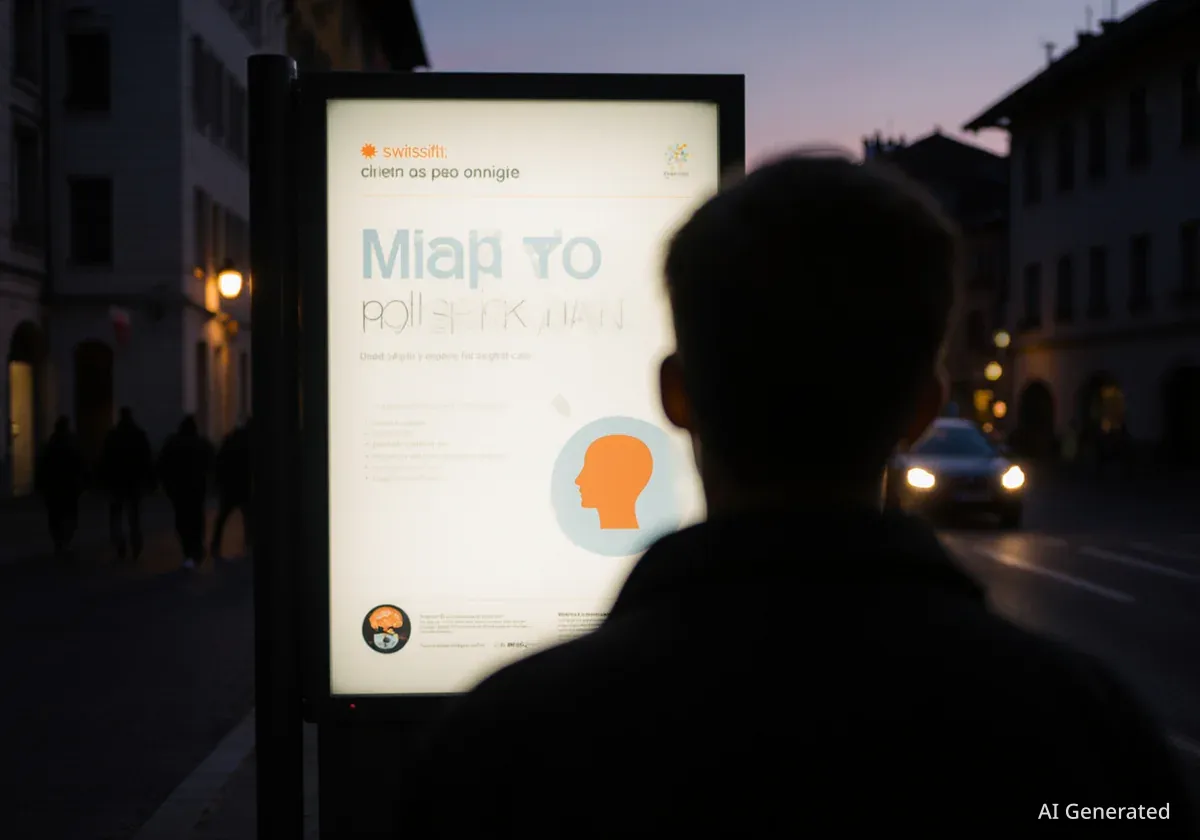Das Schweizer Gesundheitswesen befindet sich in einem stetigen Wandel. Aktuelle Berichte zeigen sowohl finanzielle Herausforderungen als auch Fortschritte in der Patientenversorgung und der Digitalisierung. Gleichzeitig bleibt der Bedarf an qualifiziertem Pflegepersonal hoch, mit zahlreichen offenen Stellen in verschiedenen Fachbereichen.
Wichtige Erkenntnisse
- Das Spital Wallis verzeichnet voraussichtlich erneut einen Verlust.
- Automatisierter Datenaustausch verbessert Effizienz und Sicherheit der Patientenversorgung.
- Spitäler im Kanton Zürich zeigen finanzielle Erholungstendenzen.
- Hoher Bedarf an Dipl. Pflegefachpersonen und medizinischem Personal.
- Ärzte fordern Bürokratieabbau zur Entlastung des Klinikalltags.
Finanzielle Lage und Umstrukturierungen
Mehrere Schweizer Spitäler sehen sich weiterhin mit finanziellen Schwierigkeiten konfrontiert. Das Spital Wallis erwartet beispielsweise wieder einen höheren Verlust. Dies zeigt die anhaltende Notwendigkeit, Kostenstrukturen zu optimieren und Effizienz zu steigern.
Im Gegensatz dazu gibt es auch positive Entwicklungen. Die Spitäler im Kanton Zürich, insbesondere das Universitätsspital Zürich (USZ) und das Kantonsspital Winterthur (KSW), zeigen Anzeichen einer Erholung. Laut dem Budgetentwurf der Kantonsregierung werden für 2026 deutlich verbesserte Finanzergebnisse erwartet. Dies deutet auf erfolgreiche Umstrukturierungsmassnahmen und eine Stabilisierung der wirtschaftlichen Lage hin.
«Der Spitalbetrieb läuft zurzeit gut und trägt sich selbst», berichtet das GZO Wetzikon, dessen Gläubiger fünf Personen als Interessenvertreter bestimmt haben. Ein Antrag auf Absetzung der bisherigen Sachwalter scheiterte.
Faktencheck
- Das Spital Wallis bündelt die Akutmedizin in Sitten und plant 17 neue Operationssäle.
- Geriatrie und Rehabilitation werden in Siders und Martigny ausgebaut.
- Diese Massnahmen sollen die Gesundheitsversorgung im französischsprachigen Wallis neu strukturieren.
Fortschritte in der Digitalisierung und Patientenversorgung
Die Digitalisierung spielt eine immer wichtigere Rolle im Gesundheitswesen. Ein erfolgreiches Pilotprojekt zum automatisierten Datenaustausch von Medikationsplänen wurde zwischen mediX bern und der Lindenhofgruppe abgeschlossen. Diese Initiative hat sich als effizienter und sicherer erwiesen.
Der automatisierte Datenaustausch verbessert die Qualität und Kontrolle in der integrierten Versorgung. Er fördert die Koordination und Kommunikation zwischen den Kooperationspartnern. Dadurch können doppelte Behandlungen vermieden und Übergänge zwischen verschiedenen Versorgungseinrichtungen harmonisiert werden.
Medikationspläne: Effizienz durch Automatisierung
Die Pilotphase zeigte, dass Patienten, die im Managed Care Modell betreut werden, von diesem System profitieren. Es gewährleistet einen reibungsloseren Informationsfluss und reduziert das Risiko von Medikationsfehlern. Dies ist ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der Patientensicherheit und Effizienz.
Hintergrund: Managed Care
Managed Care ist ein Versorgungsmodell, das darauf abzielt, die Gesundheitsversorgung zu koordinieren und die Kosten zu kontrollieren. Es legt den Fokus auf präventive Massnahmen und eine integrierte Betreuung, um die Qualität der Versorgung zu steigern und unnötige Behandlungen zu vermeiden.
Personalbedarf und Fachkräftemangel
Der Bedarf an qualifiziertem Pflegepersonal bleibt in der Schweiz hoch. Zahlreiche Spitäler und Pflegeeinrichtungen suchen dringend nach Fachkräften. Zu den offenen Stellen gehören:
- Dipl. Pflegefachfrau/-mann (50-100%)
- Dipl. Pflegefachfrau/-mann mit Zusatzfunktion Berufsbildung, Herzchirurgie (80-100%)
- Gruppenleitung Pflege (50-100%)
- Abteilungsleiter/in Pflege
- Stv. Abteilungsleiter/in Pflege
- Medizinische/r Praxisassistent/in (MPA)
Diese breite Palette an Positionen unterstreicht den anhaltenden Mangel an Fachkräften im Gesundheitssektor. Es sind sowohl akademisch ausgebildete Fachkräfte (FH/HF) als auch erfahrene Führungskräfte gefragt.
Wechsel in Führungspositionen
Auch auf Managementebene gibt es wichtige Veränderungen. Markus Bischoff, Chefarzt für Anästhesiologie und Rettungsmedizin am Kantonsspital Herisau, wird ab Oktober Mitglied der Geschäftsleitung des Spitalverbunds Appenzell Ausserrhoden (SVAR). Dies zeigt die Bedeutung von medizinischem Fachwissen auch in administrativen Führungspositionen.
Stephanie Hackethal wechselt nach vier Jahren als CEO des Kantonsspitals Glarus ins Berner Oberland, um die Leitung der Spitäler FMI zu übernehmen. Solche Wechsel sind typisch für eine dynamische Branche, die stets nach erfahrenen Führungspersönlichkeiten sucht.
Bürokratieabbau und alternative Versorgungsmodelle
Ärzte fordern eine Reduzierung der Bürokratie im Klinikalltag. Viszeralchirurgen haben konkrete Vorschläge unterbreitet, welche Regeln und Gesetze ihren Alltag unnötig erschweren. Sie wünschen sich eine Vereinfachung der administrativen Prozesse, um mehr Zeit für die Patientenversorgung zu haben. Dies könnte die Arbeitszufriedenheit erhöhen und den Fachkräftemangel indirekt mildern.
Hospital at Home und Palliative Care
Das Konzept «Hospital at Home» gewinnt an Bedeutung. Die Spitex möchte dabei eine zentrale Rolle spielen, obwohl dies nicht überall der Fall ist. Dieses Modell ermöglicht Patienten, medizinische Versorgung in den eigenen vier Wänden zu erhalten, was den Druck auf die Spitäler entlasten könnte.
Im Bereich der Palliative Care fordert Renate Gurtner Vontobel, ehemalige Geschäftsführerin von Palliative.ch, «nicht mehr Betten in Spitälern, aber in Hospizen». Sie betont die Notwendigkeit, palliative Versorgung ausserhalb des Akutspitals zu stärken, um den Bedürfnissen sterbender Menschen besser gerecht zu werden.
Zahlen und Fakten
- Schätzungsweise 17% der Schweizer Bevölkerung wünschen sich eine Sterbebegleitung zu Hause.
- Hospize bieten eine spezialisierte Umgebung für palliative Patienten, die nicht zu Hause bleiben können.
Diskussion um Komplementärmedizin
Die Rolle der Komplementärmedizin im Schweizer Gesundheitssystem bleibt ein Thema. SP-Ständerätin Franziska Roth kritisiert, dass Gegner der Komplementärmedizin eine zu einseitige Sichtweise hätten. Sie betont den Wert der ärztlichen Expertise, die auch komplementärmedizinische Ansätze integrieren kann.
Die Debatte zeigt, dass das Schweizer Gesundheitswesen offen für verschiedene Behandlungsansätze ist, aber auch eine kritische Auseinandersetzung mit deren Wirksamkeit und Integration erfordert. Eine ausgewogene Perspektive, die sowohl konventionelle als auch komplementäre Methoden berücksichtigt, wird angestrebt.