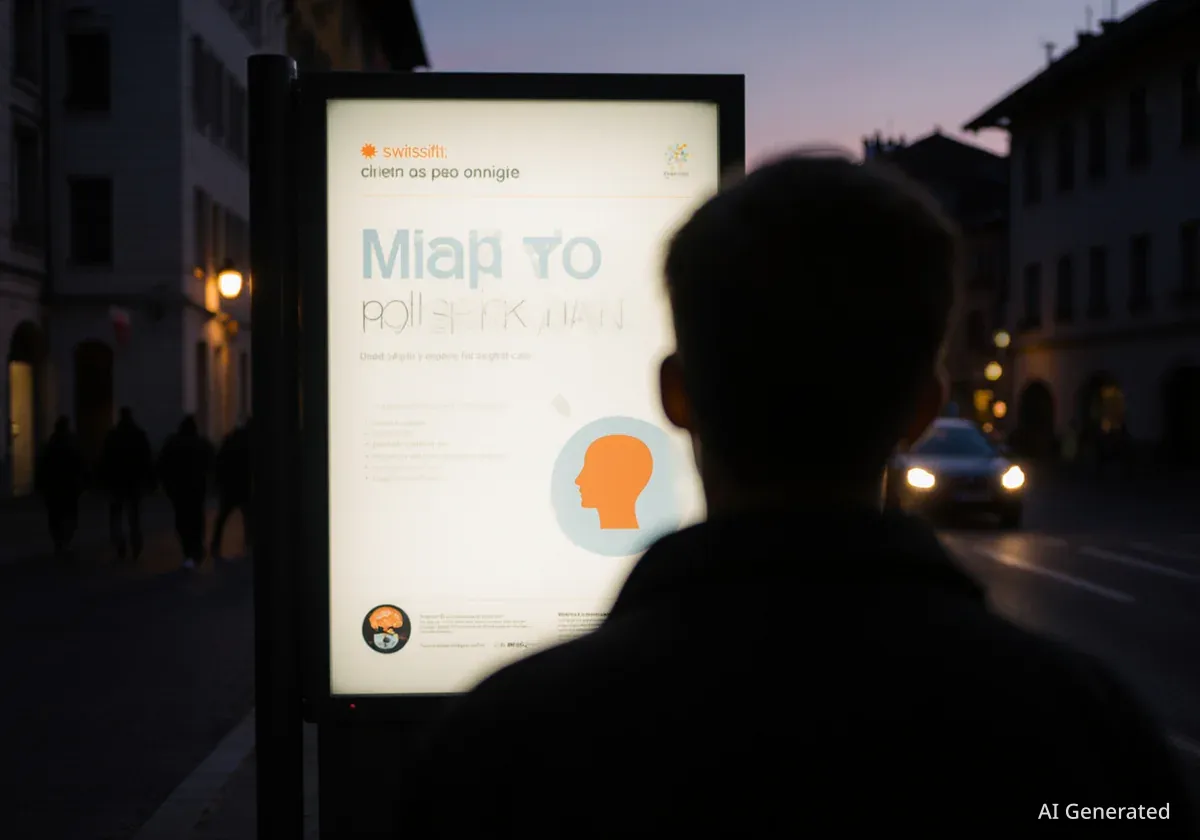Die Schweizer Spitallandschaft erlebt einen tiefgreifenden Wandel. Angesichts steigenden wirtschaftlichen Drucks, Fachkräftemangels und dem Bedürfnis nach ständiger Weiterentwicklung stehen Spitäler vor komplexen Herausforderungen. Gleichzeitig entstehen innovative Ansätze und Kooperationen, um die Qualität der Versorgung zu sichern und zukunftsfähig zu bleiben.
Wichtige Erkenntnisse
- Spitäler sehen sich mit wachsendem wirtschaftlichem Druck konfrontiert.
- Der Fachkräftemangel, insbesondere in der Pflege und bei selbständigen Ärzten, verschärft sich.
- Kooperationen zwischen Spitälern und die Spezialisierung von Kliniken nehmen zu.
- Technologische Innovationen wie KI und Telemedizin spielen eine immer grössere Rolle.
- Nachhaltigkeit und Energieeffizienz werden zu wichtigen strategischen Zielen.
Wirtschaftlicher Druck und Fachkräftemangel prägen den Alltag
Die Lindenhofgruppe in Bern betont, dass sie als Qualitätsführerin in Medizin und Pflege die Herausforderungen frühzeitig erkennen und ihr Angebot stetig weiterentwickeln muss. Dies ist entscheidend, um dem steigenden wirtschaftlichen Druck wirkungsvoll zu begegnen. Viele Spitäler sehen sich mit ähnlichen Problemen konfrontiert.
Ein zentrales Problem ist der anhaltende Fachkräftemangel. Offene Stellen für dipl. Pflegefachpersonen, Physiotherapeuten mit neurologischem Schwerpunkt und Gruppenleitungen in der Pflege sind keine Seltenheit. Der Bedarf an qualifiziertem Personal bleibt hoch.
Faktencheck: Personalmangel
- Der Mangel an selbständigen Ärzten wird sich voraussichtlich nicht verbessern. Eine Befragung von Medizinstudenten zeigt Engpässe bei der Organisation von Praktikumsplätzen.
- Die Höhere Fachschule Gesundheit und Soziales (HFGS) Aarau bietet seit September 2025 die Ausbildung zur dipl. Pflegefachperson HF auch im Teilzeitmodell (70%) an, um dem Bedarf entgegenzuwirken.
Die Suche nach qualifizierten Fachkräften ist intensiv. Spitäler wie Zurzach Care und Hirslanden AG suchen aktiv nach neuen Mitarbeitenden. Dies zeigt, wie angespannt der Arbeitsmarkt im Gesundheitswesen ist.
Spezialisierung und Kooperationen als Lösungsansätze
Um die medizinische Versorgung auf hohem Niveau zu halten und Ressourcen effizienter zu nutzen, setzen Spitäler zunehmend auf Spezialisierung und Kooperationen. Dies ermöglicht es ihnen, bestimmte Leistungen zu bündeln und die Expertise zu vertiefen.
Ein Beispiel hierfür ist die gemeinsame Gefässchirurgie im Berner Oberland. Die Spitalgruppen STS, Fmi und Insel kooperieren unter dem Namen «Gefässchirurgie Berner Oberland». Ab nächster Woche werden sie in der operativen Gefässmedizin zusammenarbeiten. Solche Zusammenschlüsse optimieren die Patientenversorgung und bündeln Fachwissen.
«Kooperationen sind der Schlüssel, um die medizinische Versorgung in ländlichen Regionen zu sichern und gleichzeitig Spezialwissen zugänglich zu machen», so ein Sprecher der beteiligten Spitalgruppen.
Auch das Spital Muri baut seine Orthopädie aus und hat Christian Hank als Chefarzt für diesen Bereich gewonnen. Dies unterstreicht den Trend zur fachlichen Vertiefung innerhalb der einzelnen Kliniken.
Technologische Fortschritte und KI im Gesundheitswesen
Die digitale Transformation macht auch vor dem Gesundheitswesen nicht Halt. Künstliche Intelligenz (KI) und andere Technologien versprechen, Spitäler zukunftsfähig zu machen. Sie können beispielsweise bei der Diagnostik, der Therapieplanung oder der Effizienzsteigerung administrativer Prozesse unterstützen.
Das Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) und die ETH Zürich haben ein Rahmenabkommen zur gemeinsamen biomedizinischen Forschung unterzeichnet. Diese Partnerschaft zeigt das Potenzial von Forschung und Entwicklung, um medizinische Innovationen voranzutreiben und die Patientenversorgung zu verbessern.
Hintergrund: KI in Spitälern
KI-Anwendungen können Ärzte bei der Analyse grosser Datenmengen unterstützen, etwa bei der Auswertung von Röntgenbildern oder der Identifizierung von Risikofaktoren. Dies kann zu präziseren Diagnosen und personalisierten Behandlungsplänen führen. Die Integration solcher Systeme erfordert jedoch erhebliche Investitionen und eine sorgfältige Implementierung.
Die Lindenhofgruppe blickt ebenfalls in die Zukunft und investiert in digitale Lösungen. Dies ist entscheidend, um den steigenden Anforderungen an Effizienz und Qualität gerecht zu werden.
Führungswechsel und strategische Neuausrichtung
Veränderungen in der Spitalleitung sind ein weiterer Indikator für den dynamischen Wandel. Solche Wechsel gehen oft mit neuen strategischen Ausrichtungen einher, die auf die aktuellen Herausforderungen reagieren.
Ein Beispiel ist der Wechsel an der Spitze der Klinik Lengg. Auch das Gesundheitszentrum Fricktal (GZF) erlebt einen überraschenden Abgang: CEO Oliver Grossen tritt aus persönlichen Gründen zurück, nachdem er erst im Februar seine Stelle angetreten hatte. Solche personellen Veränderungen können kurzfristig Unsicherheiten mit sich bringen, bieten aber auch Chancen für eine Neuausrichtung.
Im Spital Region Oberaargau (SRO) wurde die Nachfolge für die CEO-Position bereits geregelt: Timo Thimm, der bisherige COO, übernimmt die Funktion im Januar 2026. Dies sorgt für Kontinuität und eine geordnete Übergabe.
Nachhaltigkeit als strategisches Ziel
Neben medizinischen und wirtschaftlichen Aspekten gewinnt auch die Nachhaltigkeit an Bedeutung. Spitäler erkennen zunehmend ihre Verantwortung, ressourcenschonend zu arbeiten und ihren ökologischen Fussabdruck zu reduzieren.
Die Lindenhofgruppe engagiert sich seit 2015 freiwillig als Teilnehmerin der Energie-Agentur der Wirtschaft (EnAW). Im Februar 2024 erhielt die Gruppe erneut ein aktuelles Zertifikat, was ihr Engagement für Energieeffizienz und Klimaschutz unterstreicht. Solche Initiativen tragen nicht nur zum Umweltschutz bei, sondern können auch Kosten senken.
Wussten Sie schon?
Der Energieverbrauch in Spitälern ist aufgrund des 24/7-Betriebs, der komplexen Medizintechnik und der hohen Hygieneanforderungen besonders hoch. Massnahmen zur Energieeffizienz haben daher einen grossen Hebel.
Die Integration von Nachhaltigkeitszielen in die Unternehmensstrategie wird für viele Gesundheitseinrichtungen immer wichtiger. Es geht darum, langfristig eine verantwortungsvolle und zukunftsfähige Gesundheitsversorgung sicherzustellen.
Herausforderungen in der Vorsorge und Prävention
Auch im Bereich der Prävention und Vorsorge gibt es Handlungsbedarf. Nationale Kennzahlen zur Brustkrebstherapie zeigen, dass Brustkrebs in der Schweiz zwar früh entdeckt wird, es jedoch bei den Screeningprogrammen Verbesserungsbedarf gibt. Eine effektive Vorsorge ist entscheidend, um Krankheiten frühzeitig zu erkennen und die Heilungschancen zu erhöhen.
Ein weiterer Aspekt ist das kindliche Übergewicht. Das BMI-Monitoring zeigt einen leichten Rückgang bei Schweizer Schulkindern. Allerdings bleibt das Risiko für Kinder aus bildungsfernen Familien erhöht. Dies unterstreicht die Notwendigkeit gezielter Präventionsprogramme, die soziale Ungleichheiten berücksichtigen.
Die Schweizer Spitallandschaft steht vor einer spannenden, aber auch anspruchsvollen Zukunft. Die Fähigkeit, sich anzupassen, zu innovieren und zusammenzuarbeiten, wird entscheidend sein, um die hohe Qualität der Gesundheitsversorgung langfristig zu gewährleisten.