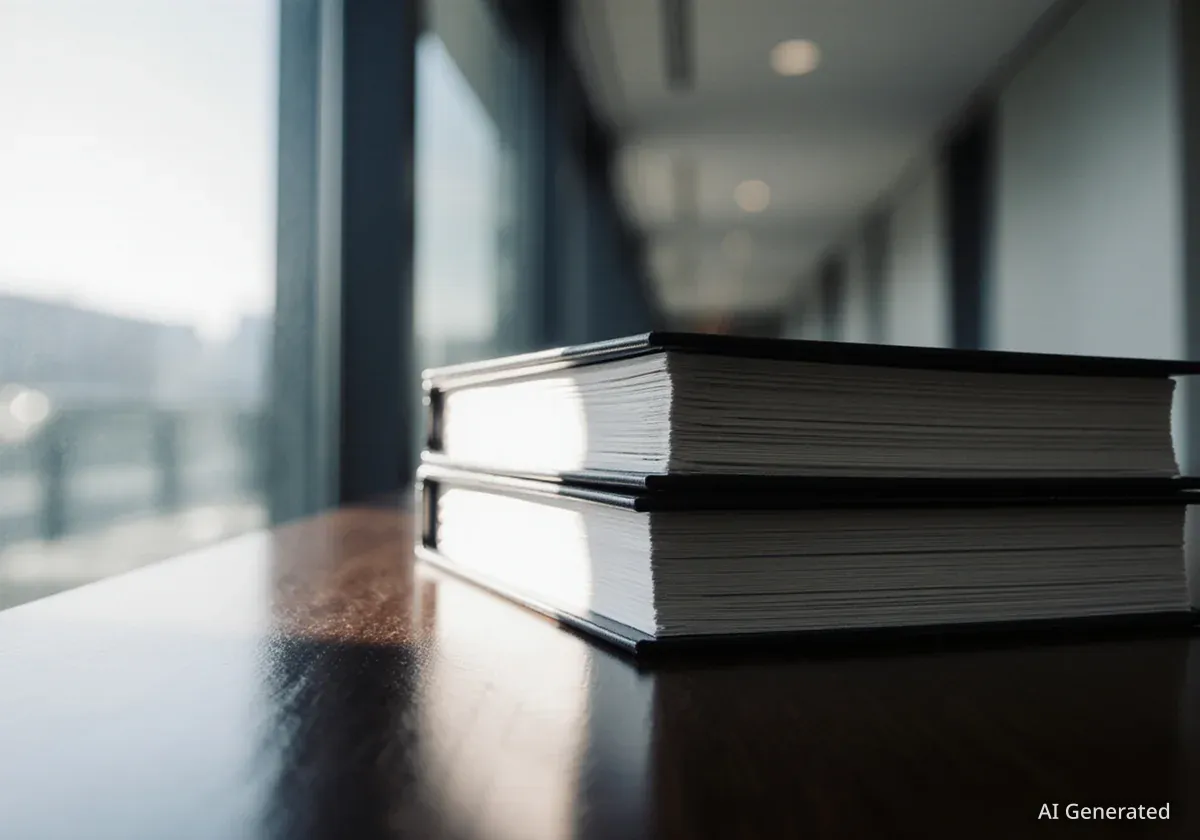Stefan Hofmann aus Bauma ist blind und auf eine spezielle Software angewiesen, um am digitalen Leben teilzunehmen. Als ein wichtiges Update für rund 1500 Franken anstand, lehnte die IV-Stelle Zürich die Kostenübernahme zunächst ab. Der Grund: Sein jährliches Einkommen lag 200 Franken unter einer internen Grenze für berufliche Hilfsmittel. Ein Kampf gegen bürokratische Hürden begann.
Für den 56-Jährigen stand plötzlich seine gesamte digitale Selbstständigkeit auf dem Spiel. Ohne die Software kann er weder E-Mails bearbeiten noch Fahrpläne abrufen. Erst nach seiner Intervention und einer Anfrage unserer Redaktion wurde der Entscheid korrigiert.
Das Wichtigste in Kürze
- Die IV lehnte die Kosten für ein Software-Update eines blinden Mannes ab, weil sein Berufseinkommen 200 Franken zu niedrig war.
- Gesetzlich hat der Mann jedoch unabhängig von seiner Erwerbstätigkeit Anspruch auf das Hilfsmittel für den privaten Gebrauch.
- Ein falsch gesetztes Kreuz in einem Antragsformular, das von einer Fachstelle ausgefüllt wurde, führte zum ablehnenden Vorbescheid.
- Der Fall wirft Fragen zur digitalen Barrierefreiheit und zum Umgang von Behörden mit Menschen mit Behinderungen auf.
Ein Brief, der die digitale Welt bedrohte
Für Stefan Hofmann ist der Computer ein unverzichtbares Werkzeug. Der 56-Jährige, der seit seiner Geburt praktisch blind ist und seit 2010 gar nichts mehr sieht, nutzt einen sogenannten Screenreader. Diese Software liest ihm digitale Texte vor oder wandelt sie in Blindenschrift um.
„Dank diesem Programm kann ich selbstständig E-Mails bearbeiten, Fahrpläne abrufen und Informationen recherchieren“, erklärt Hofmann. Es ist sein Fenster zur Welt. Doch im Herbst drohte dieses Fenster sich zu schliessen. Ein zwingendes Software-Update stand an, Kostenpunkt rund 1500 Franken. Ohne dieses Update wäre sein Screenreader ab November unbrauchbar geworden.
Hofmann, der bis 2022 in Winterthur ein Geschäft für Blindenhilfsmittel führte, hatte die Kosten für solche Updates in der Vergangenheit stets problemlos über die IV abrechnen können. Doch dieses Mal war alles anders. Per Post traf ein Vorbescheid der IV-Stelle Zürich ein: „Das Leistungsbegehren wird abgewiesen.“ Für Hofmann war das ein Schock.
200 Franken unter der Grenze
Die Begründung der IV war rein rechnerischer Natur. Hofmann gibt in Bauma in einem kleinen Pensum Handorgelunterricht und verdient damit jährlich rund 4800 Franken. In dem Schreiben der IV hiess es, die Kosten für berufliche Hilfsmittel würden erst ab einem Erwerbseinkommen von 5000 Franken pro Jahr übernommen.
„Damit erfüllen Sie die Voraussetzungen nicht“, schloss die Behörde. Eine Differenz von nur 200 Franken sollte ihm den Zugang zur digitalen Kommunikation verwehren. „Ich brauche den Reader, um meinen Schülern Rechnungen ausstellen zu können“, sagt Hofmann, für den die Ablehnung unverständlich war.
Anspruch gesetzlich verankert
Was die IV in ihrem ersten Bescheid offenbar nicht berücksichtigte, ist eine klare Regelung im Invalidengesetz. Dort ist festgehalten, dass Personen, die für die „Herstellung des Kontakts mit der Umwelt“ ein Lese- und Schreibsystem benötigen, ohne Rücksicht auf die Erwerbstätigkeit Anspruch darauf haben. Der Screenreader fällt genau in diese Kategorie.
Stefan Hofmann wusste um sein Recht. „Ich habe sowohl privat wie beruflich Anrecht auf die Unterstützung“, betont er. Seine Situation als blinder Mann habe sich in den letzten 15 Jahren schliesslich nicht geändert.
Ein Fehler im Formular mit grossen Folgen
Die Ursache für das Problem lag in einem Detail, das ausserhalb von Hofmanns Kontrolle lag. Den Antrag auf Kostenübernahme stellt nicht er direkt, sondern die schweizerische Fachstelle für Sehbehinderte im Beruflichen Umfeld (SIBU) in Basel, bei der er die Software beziehen muss.
Bei der Antragsstellung hatte die SIBU angekreuzt, es handle sich um ein rein berufliches Hilfsmittel. Dies löste bei der IV die Prüfung der Einkommensgrenze aus und führte zur automatischen Ablehnung.
„Es ist bezeichnend, dass man bei der IV zuerst mal erklären muss, was ein Screenreader überhaupt ist.“Stefan Hofmann
Nachdem Hofmann Einwände gegen den Vorbescheid erhoben hatte und diese Redaktion bei der IV-Stelle Zürich nachfragte, kam die Wende. Kurze Zeit später erhielt er die definitive Verfügung: Die Kosten für das Update werden doch übernommen. Daniela Aloisi, Kommunikationsverantwortliche der IV-Stelle Zürich, erklärte, der ablehnende Vorbescheid sei aufgrund des Antrags auf ein berufliches Hilfsmittel korrekt gewesen. Erst durch Hofmanns Rückmeldung sei die Grundlage neu beurteilt worden.
Aloisi hebt den Wert des Vorbescheids hervor, der es Betroffenen erlaube, sich „ohne formale Einsprache“ zu melden. Für Hofmann bleibt jedoch der Eindruck einer weiteren unnötigen Hürde. „Hätte man mein Dossier konsultiert, bevor der negative Bescheid rausging, wäre der Fehler aufgefallen“, ist er überzeugt.
Mangelndes Verständnis für die Lebensrealität
Der Fall offenbart für Stefan Hofmann ein tieferliegendes Problem: ein mangelndes Verständnis der Behörden für die Lebensrealität von Menschen mit einer Sehbehinderung. Dies zeige sich nicht nur im Umgang mit Anträgen, sondern auch in der alltäglichen Kommunikation.
So erhielt er den ablehnenden Bescheid per Briefpost, obwohl er um elektronische Kommunikation gebeten hatte. Der Brief enthielt einen QR-Code für weiterführende Informationen. „Wie soll ich als Blinder auf einem Blatt Papier einen QR-Code finden und einlesen?“, fragt Hofmann rhetorisch. Seine Partnerin musste ihm helfen.
Barrierefreiheit im Internet bedeutet, dass Webseiten, Apps und digitale Dokumente so gestaltet sind, dass sie von allen Menschen, einschliesslich solchen mit Behinderungen, genutzt werden können. Für blinde Menschen sind dies zum Beispiel Screenreader-Kompatibilität und Alternativtexte für Bilder.
Die IV-Stelle begründet die Kommunikation per Post mit dem Datenschutz. Für Hofmann ist es jedoch ein weiteres Beispiel dafür, wie weit der Weg zu einer wirklich barrierefreien Gesellschaft noch ist. Für ihn war der Kampf um die 1500 Franken mehr als nur eine finanzielle Frage – es war ein Kampf um Selbstständigkeit und Teilhabe.