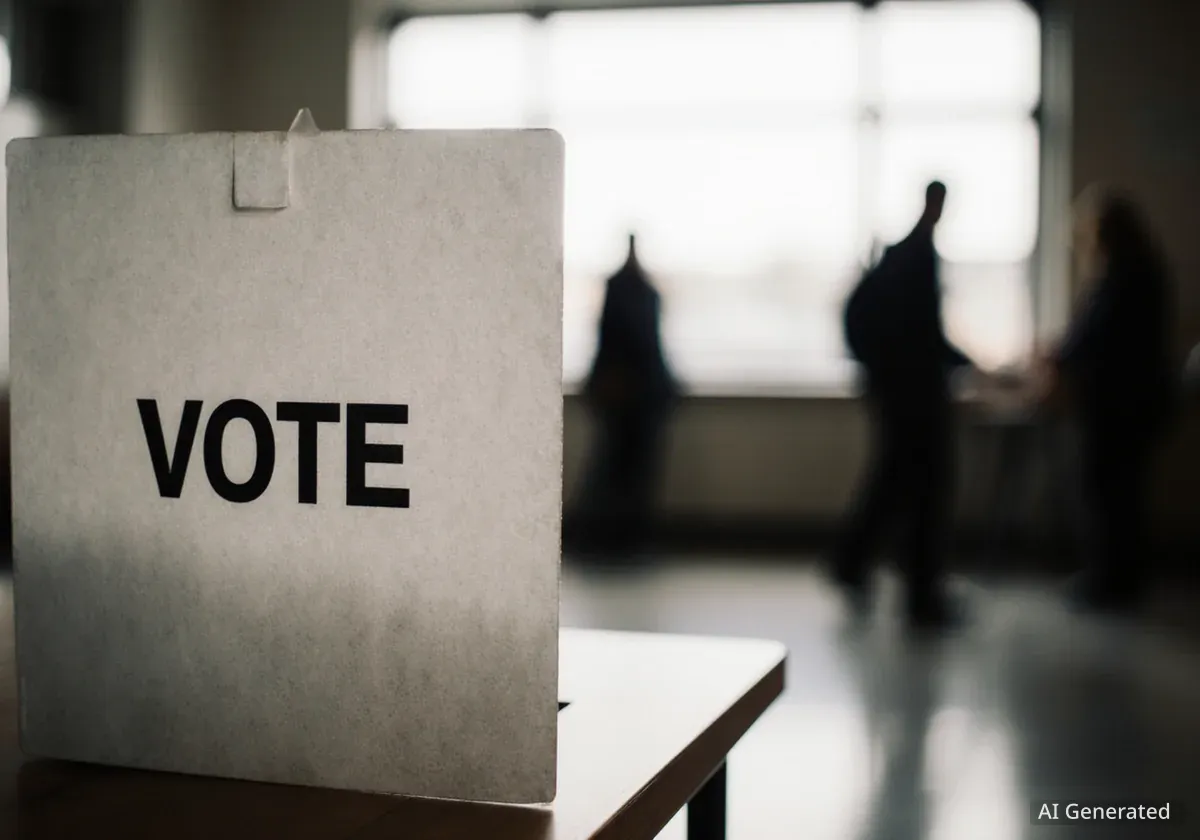Vor über 50 Jahren, im August 1970, markierte ein Abkommen zwischen der Schweiz und Deutschland einen historischen Wendepunkt für Wanderfreunde. Die Zollkreisdirektion Schaffhausen gab damals bekannt, dass 22 zuvor gesperrte Grenzübergänge an der sogenannten grünen Grenze für Fusswanderer geöffnet wurden. Dies ermöglichte es erstmals seit 1952, abseits der offiziellen Kontrollstellen die Grenze zu überqueren und die Natur beidseits des Rheins zu erkunden.
Wichtige Punkte
- Im August 1970 wurden 22 Grenzübergänge für Wanderer geöffnet.
- Dies war das Ergebnis eines neuen Abkommens zwischen der Schweiz und Deutschland.
- Die Regelung von 1970 ersetzte ein strengeres Abkommen von 1952.
- Betroffene Kantone waren Zürich, Aargau und Schaffhausen.
- Tafeln kennzeichneten die erlaubten Wanderwege.
- Wanderer benötigten gültige Grenzübertrittspapiere.
Ein Historischer Schritt für Wanderer
Die Mitteilung der Zollkreisdirektion Schaffhausen vom 7. August 1970 in der NZZ wurde von vielen Wanderern als «hocherfreuliche Nachricht» empfunden. Nach jahrelangen Verhandlungen gab es endlich weitreichende Erleichterungen für den Grenzübertritt.
Das neue Abkommen über den Grenzübertritt von Personen im kleinen Grenzverkehr ermöglichte es, die Grenze auch ausserhalb der amtlich zugelassenen Grenzübergangsstellen zu passieren. Diese Lockerung war eine direkte Reaktion auf das restriktivere Übereinkommen von 1952, das den Grenzübertritt für Wanderer nur zu festgelegten Zeiten und an offiziellen Übergängen erlaubte.
Die Öffnung betraf insgesamt 22 Stellen in den Kantonen Zürich, Aargau und Schaffhausen. Wanderer konnten die Grenze nun tagsüber legal überqueren. Als Orientierungspunkte dienten dabei einzelne Grenzsteine, die als «Ort des erlaubten Grenzübertritts» definiert wurden. Es war auch explizit erlaubt, die Wege in umgekehrter Richtung zu nutzen.
Faktencheck
- Jahr der Öffnung: 1970
- Anzahl der neuen Übergänge: 22
- Betroffene Kantone: Zürich, Aargau, Schaffhausen
- Vorherige Regelung: Übereinkommen von 1952 (strengere Kontrollen)
Gekennzeichnete Wege und klare Regeln
Die neu geöffneten Wanderwege erhielten spezielle Hinweistafeln. Darauf stand: «Grenzübergang für Fusswanderer, bei Tag, mit gültigen Grenzübertrittspapieren (ausgenommen visumpflichtige Ausländer). Mitführen von Waren nicht gestattet.» Diese Tafeln sind teilweise bis heute an der grünen Grenze zu finden.
Die Zollbehörden appellierten an die Disziplin der Wanderer. Sie baten darum, die Bedingungen genau einzuhalten, um Missbräuche zu vermeiden. Damals befürchtete man vor allem einen Anstieg des Schmuggels. Heute gilt dies immer noch. Obwohl die Schweiz seit 2008 Teil des Schengenraums ist und seit 2009 die Grenzkontrollen zwischen Deutschland und der Schweiz weitgehend entfallen sind, ist ein gültiges Ausweispapier weiterhin Pflicht. Deutschland hat in jüngster Zeit die Grenzkontrollen wieder verschärft.
«Wir bitten deshalb die Wanderer, sich an die erwähnten Bedingungen zu halten. Es wäre schade, wenn die erreichten, doch recht weitgehenden Erleichterungen zu Missbräuchen führen würden.»
Die Rolle des Personalmangels
Die Entscheidung zur Öffnung der Wanderwege war nicht nur eine Geste an die Wanderfreunde. Ein Kreisschreiben des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements vom Juni 1970 deutet darauf hin, dass auch Personalengpässe bei den Grenzkontrollorganen eine Rolle spielten. Aufgrund dieser Knappheit mussten verschiedene Übergänge zuvor ganz oder teilweise geschlossen werden.
Das Abkommen von 1970 brachte nicht nur Erleichterungen für Wanderer, sondern auch für den grenzüberschreitenden Verkehr mit Sportbooten auf dem Bodensee und dem Hochrhein. Dies zeigt, dass die Massnahme eine umfassendere Strategie zur Entlastung der Grenzbehörden war.
Hintergrundinformationen
Das Übereinkommen von 1952 schränkte den grenzüberschreitenden Verkehr stark ein. Die Lockerung von 1970 war ein Versuch, den Bedürfnissen der Bevölkerung entgegenzukommen und gleichzeitig die administrativen Hürden zu reduzieren. Der „kleine Grenzverkehr“ bezeichnet dabei den vereinfachten Grenzübertritt für Personen, die in Grenznähe wohnen.
Grosses Interesse und weitere Öffnungen
Die neuen Wanderwege stiessen von Beginn an auf grosses Interesse. Nur anderthalb Jahre nach der ersten Öffnung gingen bei den Behörden zahlreiche Wünsche von Gemeinden, Wandervereinen und Privatpersonen nach weiteren Übergängen ein. Als Reaktion darauf vereinbarten die schweizerischen und deutschen Behörden bei einer Konferenz im Spätsommer 1971, ein weiteres Dutzend neuer Grenzübergänge in das Wanderwegnetz aufzunehmen.
Im November 1971 sah sich der Zoll jedoch veranlasst, die Bestimmungen nochmals zu präzisieren. Die Wege waren für Fussgänger und Radfahrer geöffnet, Motorfahrzeuge waren ausgeschlossen. Der Grenzübertritt war nur tagsüber erlaubt und musste bei oder zwischen den angegebenen Grenzsteinen erfolgen. Es war nicht notwendig, eine spezifische Route vor oder nach dem Grenzübertritt einzuhalten.
Zürcher Grenzöffnungen im Detail
Im Kanton Zürich wurden im August 1970 die grünen Grenzen an folgenden Orten geöffnet:
- Eglisau: Grenzstein 1 (Reutholz) – Herdern (D)
- Wasterkingen: Grenzstein 22 (Rötelibuck) – Küssaburg (D)
- Rafz: Grenzstein 52 – Berwangen (D)
- Rafz: Grenzstein 81 (Rafzerstein) – Jestetten oder Lottstetten/Balm (D) – Rheinau
- Ellikon: Anlegestelle Fähre – Balm (D) oder Grenzstein 1 – Rüdlingen oder Grenzstein 124 (Nack D) – Rafz
- Nohl: Grenzstein 1 – (D) – Grenzstein 7 – Neuhausen am Rheinfall
Diese Öffnungen erleichterten den grenzüberschreitenden Verkehr erheblich und trugen zur regionalen Verbundenheit bei.
Ausnahmen und spätere Entwicklungen
Nicht alle Wanderwege über die grüne Grenze des Kantons Zürich wurden 1970 geöffnet. Die Verbindung von Rheinau über die Kraftwerkbrücke auf die deutsche Seite bei Altenburg blieb beispielsweise bis 1980 mit einem Metalltor abgesperrt. Dieser Übergang wurde erst im August 1980 für Wanderer freigegeben, wie die «Andelfinger Zeitung» damals berichtete.
Ein Detachement der Armee baute 1980 Panzersperren in Rheinau zurück und hob die Sperre beim Hauptwehr auf. Heute ist das grenzüberschreitende Hauptwehr des Kraftwerks Rheinau Teil einer beliebten Wanderroute. Dies zeigt, dass die Öffnung der Grenzen ein schrittweiser Prozess war, der sich über Jahre hinzog.
Der Verband Schweizer Wanderwege berichtet, dass es heute grundsätzlich keine Schwierigkeiten beim Grenzübertritt auf länderübergreifenden Wanderwegen gibt. Die Zugehörigkeit der Schweiz zum Schengenraum seit 2008 und die damit verbundenen kontrollfreien Grenzüberquerungen seit 2009 haben die Situation stark vereinfacht. Dennoch bleibt die Mitführung eines gültigen Ausweispapiers eine wichtige Empfehlung, insbesondere angesichts der aktuellen Verschärfung der Grenzkontrollen durch Deutschland.