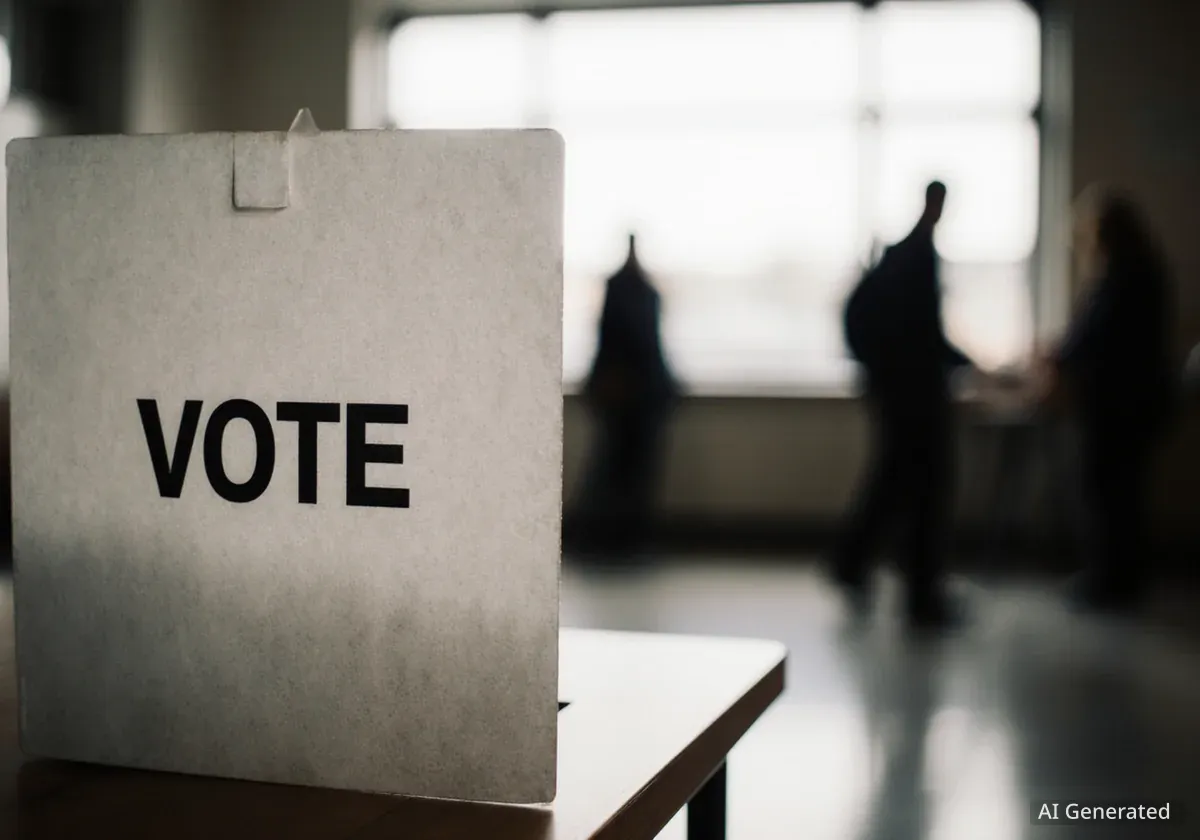Die Wohnungsnot und die steigenden Mieten im Kanton Zürich bereiten der Bevölkerung grosse Sorgen. Aus diesem Grund empfehlen die Präsidien der drei grössten Städte des Kantons – Zürich, Winterthur und Uster – ein klares Ja zur Volksinitiative «Für mehr bezahlbare Wohnungen». Über diese Initiative wird am 30. November 2025 abgestimmt. Die Stadtpräsidien sehen in der Initiative einen entscheidenden Schritt, um die Attraktivität des Kantons langfristig zu sichern und Gemeinden neue Handlungsspielräume zu eröffnen.
Wichtigste Punkte
- Zürich, Winterthur und Uster unterstützen die Initiative «Für mehr bezahlbare Wohnungen».
- Die Initiative soll Gemeinden ein Vorkaufsrecht für Grundstücke ermöglichen.
- Ein Vorkaufsrecht würde gezielt den gemeinnützigen Wohnungsbau fördern.
- Der Gegenvorschlag wird als unzureichend und rechtlich umstritten kritisiert.
- Die aktuelle Wohnsituation gefährdet die Attraktivität des Kantons Zürich.
Dringender Handlungsbedarf im Kanton Zürich
Die aktuelle Situation auf dem Zürcher Wohnungsmarkt stellt Städte und Gemeinden vor enorme Herausforderungen. Immer mehr Menschen finden keine bezahlbare Unterkunft mehr. Dies betrifft nicht nur junge Familien, sondern zunehmend auch ältere Menschen, die aus ihren angestammten Wohnungen verdrängt werden.
Corine Mauch, die Stadtpräsidentin von Zürich, betonte an einer gemeinsamen Medienkonferenz die Ernsthaftigkeit der Lage. Sie warnte davor, dass die anhaltende Wohnungsnot die Attraktivität des Kantons Zürich mittelfristig gefährdet. Ohne neue Lösungen könnten qualifizierte Arbeitskräfte und Familien abwandern, was weitreichende Konsequenzen für die Wirtschaft und Gesellschaft hätte.
Faktencheck
- Die Initiative wird am 30. November 2025 zur Abstimmung kommen.
- Das Vorkaufsrecht gilt für Grundstücke und grössere Immobilien.
- Es soll den Erwerb für gemeinnützigen Wohnungsbau erleichtern.
Das vorgeschlagene Vorkaufsrecht als Lösung
Die Volksinitiative schlägt ein Vorkaufsrecht für Gemeinden vor. Dieses Instrument würde es den Kommunen ermöglichen, gezielt Grundstücke oder grössere Immobilien zu erwerben. Der Zweck dahinter ist klar definiert: die Schaffung von mehr bezahlbarem Wohnraum, insbesondere im gemeinnützigen Bereich.
Michael Künzle, der Stadtpräsident von Winterthur, sieht darin eine pragmatische und praxisnahe Lösung. Er erklärte, dass dieses Vorkaufsrecht es den Gemeinden erlauben würde, in spezifischen Fällen preisgünstigen Wohnraum zu realisieren. Solche Projekte wären ohne dieses neue Gemeinderecht oft nicht umsetzbar.
«Das Vorkaufsrecht erlaubt, in spezifischen Fällen preisgünstigen Wohnraum zu realisieren, der ohne dieses neue Gemeinderecht nicht realisiert werden könnte.»
Die Befürworter der Initiative sehen darin eine Möglichkeit, der Spekulation auf dem Immobilienmarkt entgegenzuwirken und Wohnraum wieder stärker als Grundbedürfnis zu betrachten. Es geht darum, eine Balance zwischen Angebot und Nachfrage herzustellen, die auch Menschen mit kleinerem Budget eine Chance gibt.
Auswirkungen auf verschiedene Gemeindetypen
Die Initiative ist nicht nur für grosse Städte wie Zürich und Winterthur relevant, sondern auch für mittelgrosse Städte und kleinere Gemeinden. Barbara Thalmann, die Stadtpräsidentin von Uster, betonte, dass die Volksinitiative auch in deren Interesse liegt.
Sie schilderte Beispiele, bei denen Rentnerpaare ihre Wohnung verlieren und dann aus ihrem vertrauten Umfeld oder sogar aus der Gemeinde wegziehen müssen, weil sie sich nichts mehr leisten können. Solche Fälle zeigen deutlich, wie breit das Problem der Wohnungsnot gestreut ist und wie dringend Handlungsbedarf besteht.
Hintergrundinformationen
Gemeinnütziger Wohnungsbau zeichnet sich dadurch aus, dass er nicht auf Gewinnmaximierung abzielt. Die Mieten sind in der Regel tiefer als im freien Markt, und die Wohnungen bleiben langfristig bezahlbar. Dies ist ein wichtiger Pfeiler der sozialen Wohnversorgung und trägt zur Durchmischung der Bevölkerung bei.
Ein Vorkaufsrecht würde es auch kleineren Gemeinden ermöglichen, aktiv in die Wohnraumentwicklung einzugreifen und so die soziale Kohäsion zu stärken. Es geht darum, dass alle Bürgerinnen und Bürger, unabhängig von ihrem Einkommen, die Möglichkeit haben, in ihrer gewünschten Gemeinde zu leben.
Kritik am Gegenvorschlag des Kantons
Neben der Volksinitiative existiert ein Gegenvorschlag des Kantons. Die drei Stadtpräsidien übten jedoch scharfe Kritik an diesem Gegenvorschlag. Sie bezeichneten ihn als «Scheingegenvorschlag», der mit einer sachlichen Würdigung der Volksinitiative wenig gemeinsam habe.
Der Hauptkritikpunkt ist, dass der Gegenvorschlag den Gemeinden keine neuen Handlungsmöglichkeiten bietet. Er konzentriert sich zudem auf den subventionierten Wohnungsbau und nicht auf den gemeinnützigen Wohnungsbau, wie es die Initiative vorsieht. Dies ist ein entscheidender Unterschied, da der gemeinnützige Wohnungsbau langfristig stabilere und günstigere Mieten garantiert.
Ein weiterer Punkt ist die finanzielle Belastung: Der Gegenvorschlag ist für den Kanton nicht kostenneutral. Dies könnte zu Mehrausgaben führen, die letztlich von den Steuerzahlern getragen werden müssten. Das Initiativkomitee hat zudem eine Stimmrechtsbeschwerde gegen den Gegenvorschlag eingereicht, da dieser rechtlich umstritten ist.
Langfristige Vision für bezahlbaren Wohnraum
Die Unterstützung der Stadtpräsidien für die Volksinitiative unterstreicht die Notwendigkeit, das Problem der Wohnungsnot ganzheitlich anzugehen. Es geht nicht nur darum, neue Wohnungen zu bauen, sondern auch darum, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass Wohnraum für alle erschwinglich bleibt.
Ein Vorkaufsrecht wäre ein starkes Instrument, um die Gemeinden in die Lage zu versetzen, aktiv in den Wohnungsmarkt einzugreifen. Dies ist ein wichtiger Schritt, um die soziale Vielfalt in den Städten und Gemeinden zu erhalten und zu fördern.
- Stärkung der Gemeinden: Das Vorkaufsrecht gibt den Gemeinden ein wichtiges Instrument an die Hand.
- Förderung der Vielfalt: Bezahlbarer Wohnraum trägt zur sozialen Durchmischung bei.
- Langfristige Perspektive: Die Initiative zielt auf nachhaltige Lösungen ab.
Die Abstimmung am 30. November 2025 wird zeigen, ob die Bevölkerung des Kantons Zürich bereit ist, diesen Weg mitzugehen und den Gemeinden die gewünschten Handlungsspielräume zu eröffnen. Die Stadtpräsidien sind zuversichtlich, dass ein Ja zur Initiative die Lebensqualität im Kanton nachhaltig verbessern wird.