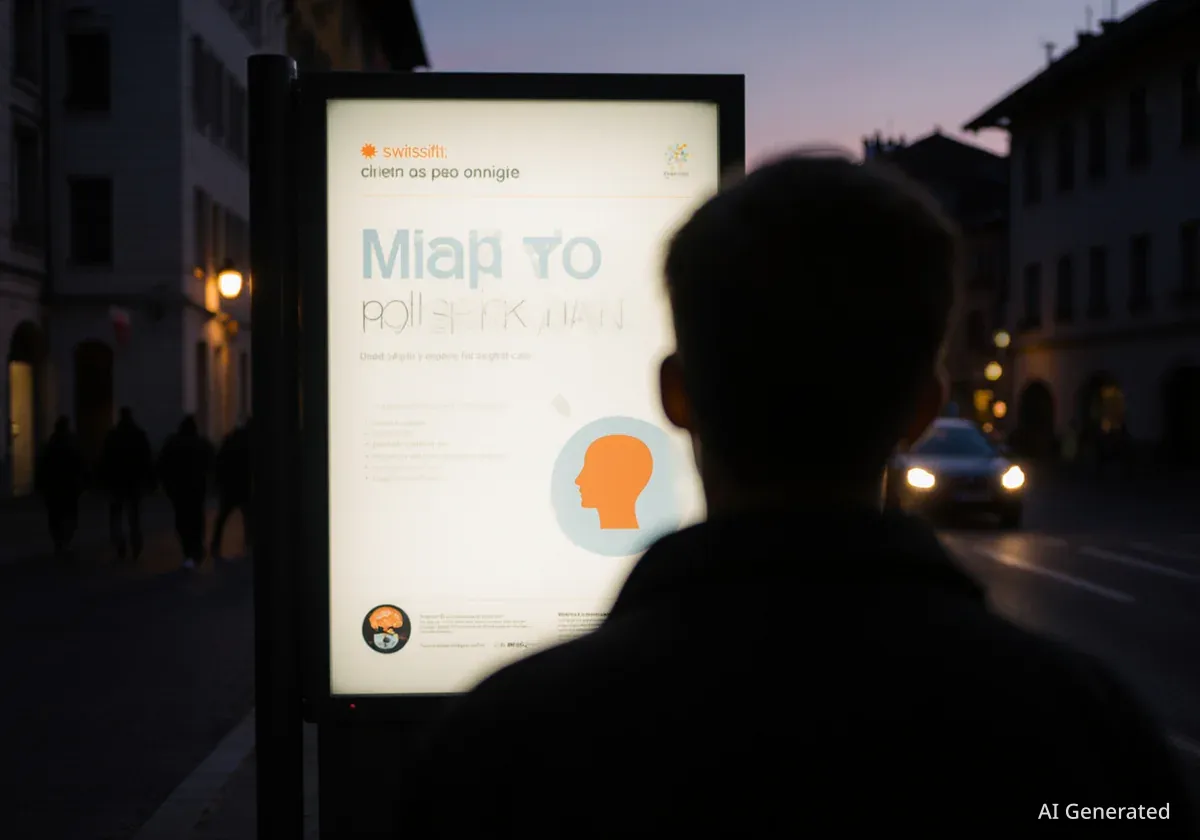In den Gesundheitszentren für das Alter der Stadt Zürich hat eine neue Ära begonnen. Tatjana Meyer-Heim übernimmt die Position der ärztlichen Direktorin von Gaby Bieri-Brüning, die das Feld der Geriatrie über 30 Jahre lang mitgeprägt hat. Dieser Wechsel wirft ein Licht auf die tiefgreifenden Veränderungen in der Altersmedizin – einem Fachgebiet, das sich von der reinen Pflege hin zu einer hochspezialisierten Disziplin entwickelt hat, in der die Lebensqualität des Einzelnen im Mittelpunkt steht.
Die beiden Expertinnen erläutern, warum die ganzheitliche Betreuung älterer Menschen wichtiger ist als je zuvor, weshalb Eiweiss im Alter entscheidend ist und wie die Gesellschaft lernen muss, offener mit dem Thema Demenz umzugehen. Ihre Einblicke zeigen eine Medizin, die nicht nur heilt, sondern begleitet, und die den Menschen hinter den Diagnosen sieht.
Das Wichtigste in Kürze
- Tatjana Meyer-Heim ist die neue ärztliche Direktorin der städtischen Gesundheitszentren für das Alter und folgt auf Gaby Bieri-Brüning.
- Die moderne Geriatrie konzentriert sich auf die Erhaltung der Lebensqualität, nicht primär auf die Verlängerung des Lebens.
- Ein ganzheitlicher Ansatz, der den gesamten Menschen und sein Umfeld einbezieht, ist das zentrale Werkzeug der Altersmedizin.
- Ein grosser Mangel an Fachkräften und die Tabuisierung von Demenz sind die grössten Herausforderungen für die Zukunft.
- Im hohen Alter ist eine eiweissreiche Ernährung entscheidend, um den Muskelabbau zu verhindern und Stürze zu vermeiden.
Ein Fachgebiet im Wandel: Von der Pflege zum Spezialgebiet
Die Geriatrie, oder Altersmedizin, hat in den letzten Jahrzehnten eine bemerkenswerte Transformation durchlaufen. Gaby Bieri-Brüning, die seit 30 Jahren in diesem Bereich tätig ist, beschreibt die Anfänge als eine Zeit, in der das Fachgebiet oft mit einem negativen Image zu kämpfen hatte. „Wenn ich sagte, ich arbeite in einem Pflegeheim, änderte sich der Gesichtsausdruck meines Gegenübers schlagartig“, erinnert sie sich.
Diese Wahrnehmung hat sich grundlegend geändert. Heute ist die Geriatrie als medizinischer Schwerpunkttitel in der Schweiz anerkannt, eine Entwicklung, die erst im Jahr 2000 erfolgte. Diese Anerkennung spiegelt den Wandel in der Herangehensweise wider. „Früher hat man alte Menschen in der Sterbephase ins Badezimmer gebracht, weil man dachte, sie hätten dort ihre Ruhe“, erklärt Tatjana Meyer-Heim. Solche Praktiken sind heute unvorstellbar.
Der Mensch im Mittelpunkt
Der moderne Ansatz ist personenzentriert und ganzheitlich. Anstatt sich nur auf einzelne Krankheiten zu konzentrieren, betrachten Geriater den gesamten Menschen in seinem sozialen und psychischen Kontext. „Wir untersuchen nicht nur ein Organ, sondern den ganzen Menschen“, betont Bieri-Brüning. „Checklisten, wie sie bei jüngeren Menschen angewendet werden, funktionieren bei älteren nicht.“
Ein Beispiel dafür ist die Abklärung nach einem Sturz. Statt nur die Verletzung zu behandeln, wird systematisch nach Ursachen wie Mangelernährung, kognitiven Einschränkungen oder auch psychischen Symptomen wie einer Depression gesucht. Dieser umfassende Blick ermöglicht es, präventiv zu handeln und weitere Stürze zu vermeiden.
Was ist Geriatrie?
Die Geriatrie ist die Lehre von den Krankheiten des alternden Menschen. Sie befasst sich mit den körperlichen, geistigen, funktionalen und sozialen Aspekten bei der Betreuung von älteren Patienten. Das Ziel ist nicht allein die Heilung, sondern vor allem die Erhaltung und Verbesserung der Lebensqualität und Selbstständigkeit.
Die Herausforderung Demenz und der Mangel an Fachkräften
Eine der grössten Herausforderungen in der Langzeitpflege ist der Umgang mit Demenz. Etwa 80 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner in den städtischen Gesundheitszentren sind davon betroffen. „Nur wer die Menschen kennt, kann interpretieren, wie es ihnen geht“, sagt Bieri-Brüning. Der Aufbau einer Beziehung ist daher entscheidend, was Zeit und Kontinuität erfordert.
Tatjana Meyer-Heim, die zuvor in der Anästhesie tätig war, fand in der Geriatrie genau diese Kontinuität und den tiefen menschlichen Kontakt.
„Wir haben mit Personen in einem Lebensabschnitt zu tun, in dem ihre Fassade bröckelt. Und doch schenken sie uns Vertrauen. Das ermöglicht einen Beziehungsaufbau, der die weitere Behandlung erleichtert.“
Trotz der gesellschaftlichen Relevanz bleibt Demenz oft ein Tabuthema. Viele Diagnosen werden nicht gestellt, weil Betroffene und Angehörige glauben, man könne ohnehin nichts tun. Doch das ist ein Trugschluss. „Es gibt Möglichkeiten, Demenz zu stabilisieren“, erklärt Meyer-Heim. Eine frühzeitige Diagnose gibt allen Beteiligten wertvolle Zeit, sich auf die neue Situation einzustellen.
Ein alarmierender Fachkräftemangel
Gleichzeitig steht die Geriatrie vor einem strukturellen Problem: Es fehlt an spezialisiertem Nachwuchs. „Es gibt in der Schweiz nicht genügend Geriaterinnen und Geriater“, stellt Meyer-Heim fest. Die Förderung junger Fachkräfte sieht sie als eine ihrer zentralen Aufgaben in ihrer neuen Position an, um die hohe Qualität der Versorgung auch in Zukunft sicherzustellen.
Lebensqualität vor Lebenslänge: Ein neuer Fokus
Die städtische Bevölkerung wird immer älter, und die meisten Menschen möchten so lange wie möglich in ihrem gewohnten Umfeld bleiben. Dank des Ausbaus von Spitex-Diensten ist dies heute besser möglich als noch vor einigen Jahrzehnten. Der Eintritt in ein Pflegezentrum erfolgt daher später, im Durchschnitt im Alter von 85 Jahren, und die Pflegebedürftigkeit ist bei Eintritt deutlich höher.
In diesem Kontext verschiebt sich auch das Ziel der medizinischen Behandlung. Es geht nicht mehr primär darum, das Leben um jeden Preis zu verlängern.
Pflege in Zürich in Zahlen
In den städtischen Gesundheitszentren für das Alter stehen knapp 3300 Betten für die stationäre Langzeitpflege zur Verfügung. Der durchschnittliche Eintrittsalter liegt bei 85 Jahren, was die hohe Pflegebedürftigkeit der Bewohner widerspiegelt.
„In der Geriatrie ist der Fokus anders. Wir helfen, die Lebensqualität der Patientinnen und Patienten möglichst lange zu erhalten“, so Bieri-Brüning. Bei einem 95-jährigen Patienten mit 20 Diagnosen seien nicht unbedingt die lebensbedrohlichsten Erkrankungen behandlungsrelevant, sondern jene Faktoren, die die Lebensqualität direkt beeinträchtigen – wie zum Beispiel Schmerzen.
Der Longevity-Trend aus Sicht der Expertinnen
Der aktuelle Trend zur „Longevity“, also der gezielten Verlängerung des Lebens, wird von den beiden Geriaterinnen differenziert betrachtet. „Longevity ist zunächst ein Businessmodell“, sagt Meyer-Heim. Sie stellt die Frage, ob es nicht vor allem jene anspricht, die ohnehin schon ein hohes Gesundheitsbewusstsein haben und es sich finanziell leisten können. Ein „gesundes Altern“ müsse demokratisiert werden.
Gaby Bieri-Brüning ergänzt: „Ich bin nicht sicher, ob wirklich alle lang leben wollen oder ob sie nicht einfach möglichst gut leben wollen.“ Präventive Massnahmen wie Bewegung, soziale Kontakte und eine gute Ernährung sind unbestritten wichtig, um lange fit zu bleiben. Doch ab einem Alter von 80 Jahren steigt das Risiko für Alterserkrankungen deutlich an.
Die entscheidende Rolle der Ernährung im Alter
Ein gutes Gesundheitsbewusstsein in der Bevölkerung kann für Geriater auch zu neuen Herausforderungen führen. Oftmals übertragen Angehörige ihre eigenen Vorstellungen von gesunder Ernährung auf ihre betagten Eltern, was nicht immer förderlich ist.
„Wenn zum Beispiel eine Tochter darauf pocht, dass ihre betagte Mutter täglich Rohkost isst, mag das gut gemeint sein“, erklärt Bieri-Brüning. „Aber ab 85 braucht der Körper vor allem eines: Eiweiss, Eiweiss und nochmals Eiweiss.“
Der Grund dafür ist der natürliche Muskelabbau im Alter (Sarkopenie). Erhält der Körper nicht genügend Protein über die Nahrung, baut er Muskelmasse ab. Dies führt zu Schwäche, erhöht die Sturzgefahr und schränkt die Mobilität ein. Eine eiweissreiche Ernährung ist daher eine der wichtigsten Massnahmen, um die Selbstständigkeit im hohen Alter zu bewahren.