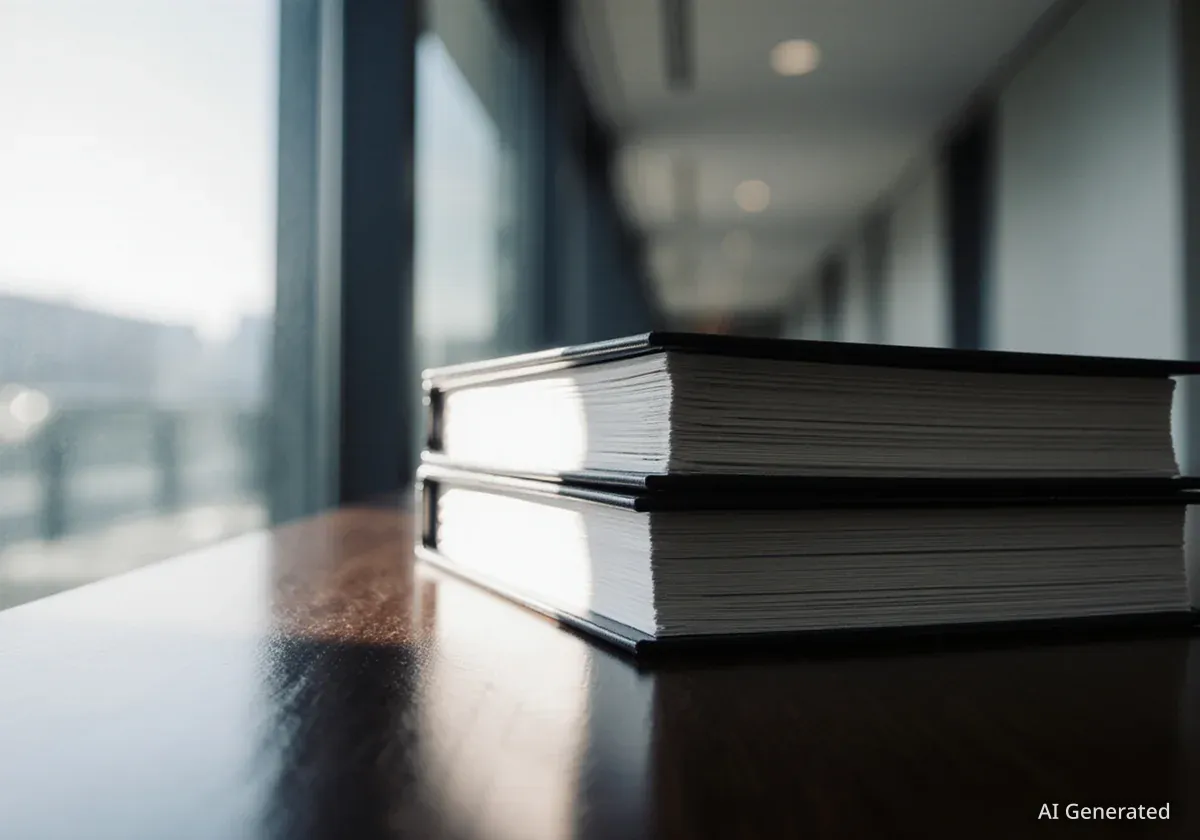Das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich hat entschieden, dass ein kantonales Amt das Arbeitszeugnis einer langjährigen Mitarbeiterin korrigieren muss. Die Beurteilung im Zeugnis entsprach nicht den durchwegs positiven Bewertungen während ihrer fast zwölfjährigen Anstellung. Der Fall unterstreicht die rechtliche Verpflichtung für Arbeitgeber, Zeugnisse sowohl wahrheitsgetreu als auch wohlwollend zu formulieren.
Das Wichtigste in Kürze
- Eine ehemalige Angestellte des Kantons Zürich hat erfolgreich gegen ihr Arbeitszeugnis geklagt.
- Das Verwaltungsgericht urteilte, dass die Formulierungen im Zeugnis ihre langjährigen sehr guten Leistungen nicht widerspiegelten.
- Der Arbeitgeber muss die Leistungsbeurteilung nun anpassen, um die gesamte Dauer des Arbeitsverhältnisses fair abzubilden.
- Das Urteil betont die in der Schweiz geltenden Grundsätze der Wahrheitspflicht und des Wohlwollens bei Arbeitszeugnissen.
Ein scheinbar positives Zeugnis mit versteckter Kritik
Nach fast zwölf Jahren im Dienst eines kantonalen Amtes in Zürich erhielt eine Mitarbeiterin die Kündigung. Das anschliessend ausgestellte Arbeitszeugnis enthielt Sätze wie: „Sie arbeitete fleissig und konzentriert. Mit ihrer gewissenhaften Arbeitsweise entsprach sie unseren Erwartungen in qualitativer wie quantitativer Hinsicht.“
Auf den ersten Blick mögen diese Formulierungen positiv klingen. In der Praxis der Arbeitszeugnisse gelten solche Aussagen jedoch oft als Code für eine lediglich durchschnittliche Leistung. Die betroffene Frau war mit dieser Bewertung nicht einverstanden und entschied sich, rechtliche Schritte einzuleiten, nachdem ein interner Rekurs erfolglos geblieben war.
Der Weg durch die Instanzen
Die Angestellte war von Juli 2012 bis zum 31. März 2024 für das kantonale Amt tätig. Nachdem das Arbeitsverhältnis aufgelöst wurde, wehrte sie sich zunächst erfolglos gegen die Kündigung selbst. Auch ihr Einspruch gegen das Arbeitszeugnis bei der zuständigen kantonalen Direktion wurde abgewiesen.
Unbeirrt zog die Frau den Fall vor das Zürcher Verwaltungsgericht und forderte eine Anpassung des Zeugnisses. Dort erhielt sie in wesentlichen Punkten recht. Das Gericht ordnete an, dass mehrere Passagen des Dokuments zu ihren Gunsten korrigiert werden müssen, wie aus dem kürzlich veröffentlichten Urteil hervorgeht.
Die Bedeutung von Arbeitszeugnissen in der Schweiz
In der Schweiz hat das Arbeitszeugnis einen hohen Stellenwert im Bewerbungsprozess. Es dient potenziellen neuen Arbeitgebern als wichtige Informationsquelle über die Leistung und das Verhalten eines Bewerbers. Aus diesem Grund sind die Formulierungen von entscheidender Bedeutung. Das Gesetz (Art. 330a OR) schreibt vor, dass ein Zeugnis wahrheitsgetreu und wohlwollend sein muss. Dieser Spagat führt oft zu einer „codierten Sprache“, die für Laien schwer zu entschlüsseln ist.
Gerichtsurteil: Diskrepanz zwischen Leistung und Beurteilung
Das Verwaltungsgericht analysierte die strittigen Formulierungen genau. In seiner Urteilsbegründung stellte es fest, dass die gewählten Sätze tatsächlich auf eine bloss durchschnittliche Leistung schliessen lassen.
„Wie die Beschwerdeführerin zutreffend vorbringt, lassen die genannten Formulierungen auf eine bloss durchschnittliche Aufgabenerfüllung und Leistung schliessen“, heisst es im Urteil des Gerichts.
Der entscheidende Punkt für das Gericht war jedoch der Vergleich mit den früheren Mitarbeiterbeurteilungen der Frau. Während ihrer langjährigen Tätigkeit wurden ihre Leistungen fast ausnahmslos mit der Note „sehr gut“ bewertet. Für das Gericht war es daher nicht nachvollziehbar, warum das Abschlusszeugnis plötzlich ein anderes Bild zeichnete.
Die angeordnete Korrektur
Aufgrund dieser Diskrepanz muss das kantonale Amt den entsprechenden Absatz im Arbeitszeugnis nun wie folgt anpassen: „Sie arbeitete fleissig und konzentriert. Mit ihrer gewissenhaften Arbeitsweise erbrachte sie gute bis sehr gute Leistungen und entsprach unseren Erwartungen in qualitativer wie quantitativer Hinsicht.“ Diese Änderung spiegelt die dokumentierten Bewertungen während der Anstellungsdauer wider.
Wahrheitspflicht vs. Wohlwollen
Das Schweizer Arbeitsrecht verlangt von Arbeitgebern, zwei oft widersprüchliche Prinzipien zu vereinen:
- Wahrheitspflicht: Das Zeugnis muss alle wesentlichen Tatsachen enthalten, die für die Gesamtbeurteilung relevant sind. Es darf kein falsches Bild erzeugen.
- Wohlwollenspflicht: Das Zeugnis soll das wirtschaftliche Fortkommen des Arbeitnehmers nicht unnötig erschweren. Offene, harte Kritik ist daher unüblich.
Gerichte müssen in Streitfällen abwägen, welches Prinzip im konkreten Fall Vorrang hat. In der Regel hat die Wahrheitspflicht ein höheres Gewicht.
Das gesamte Arbeitsverhältnis zählt
Aus den Gerichtsakten geht hervor, dass es ab dem Jahr 2019 zu Problemen in der Zusammenarbeit gekommen war. Der Frau wurde vorgeworfen, sich gegenüber Teammitgliedern und Vorgesetzten „wiederholt unbefriedigend verhalten“ zu haben. Dies führte 2022 zu einer schriftlichen Mahnung und schliesslich 2024 zur Kündigung.
Der Arbeitgeber argumentierte möglicherweise, dass die jüngsten Vorkommnisse die Gesamtbeurteilung prägen. Das Gericht vertrat jedoch eine andere Auffassung. Es betonte, dass ein Arbeitszeugnis ein „faires Abbild der gesamten Anstellungsdauer“ liefern müsse.
Obwohl die jüngste Leistung und das Verhalten für einen neuen Arbeitgeber von besonderem Interesse sind, dürfen sie nicht die positiven Leistungen über viele Jahre hinweg vollständig überschatten. Eine faire Beurteilung muss die gesamte Zeitspanne der Betriebszugehörigkeit berücksichtigen und entsprechend gewichten.
Ein wichtiges Signal für Arbeitnehmer und Arbeitgeber
Der Fall zeigt deutlich, dass Arbeitnehmer sich nicht mit einem ungerechtfertigten Zeugnis abfinden müssen. Wenn nachweislich gute oder sehr gute Leistungen über Jahre erbracht wurden, darf ein Abschlusszeugnis diese nicht einfach ignorieren oder durch verklausulierte Formulierungen abwerten.
Für Arbeitgeber ist das Urteil eine Mahnung, Zeugnisse sorgfältig und konsistent mit den internen Mitarbeiterbeurteilungen zu erstellen. Pauschale oder unbegründete Abweichungen im Abschlusszeugnis können vor Gericht angefochten werden und zu Korrekturauflagen führen. Das Urteil des Verwaltungsgerichts ist noch nicht rechtskräftig und kann an eine höhere Instanz weitergezogen werden.