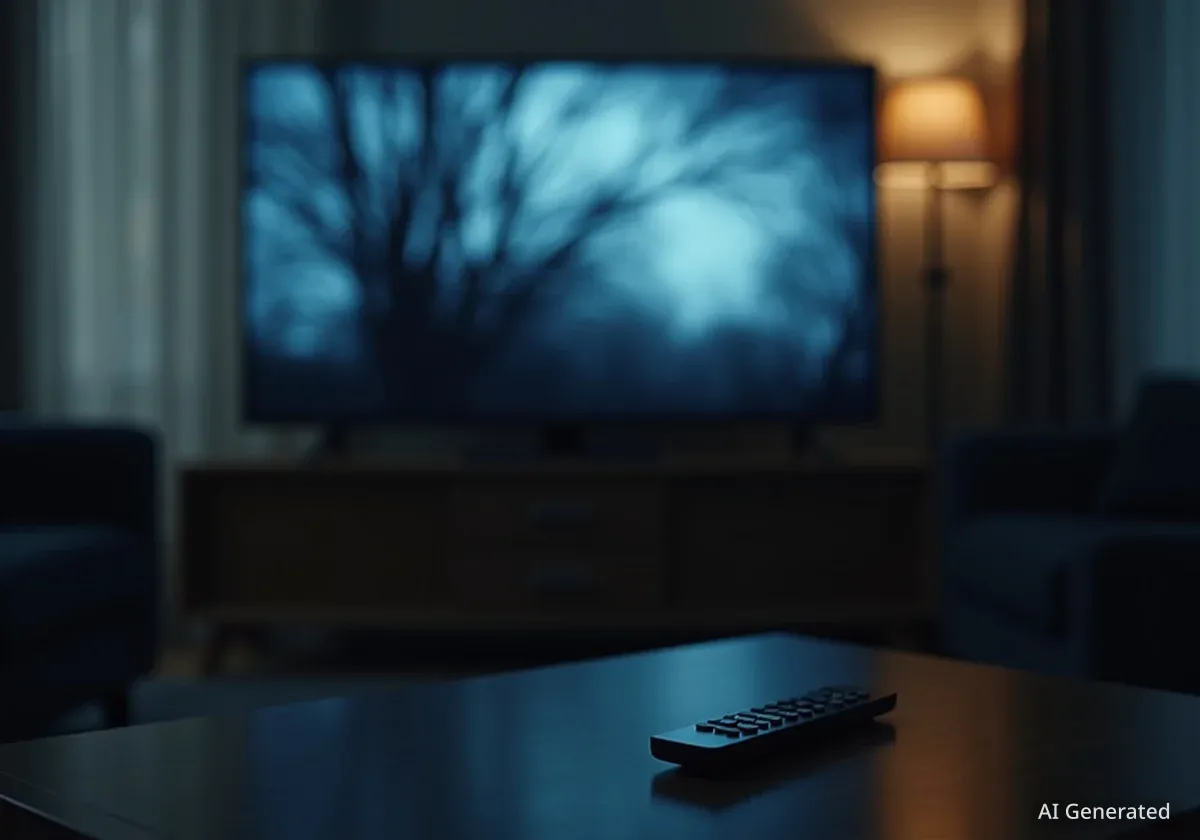Fast die Hälfte der Schweizer Bevölkerung, genau 46,4 Prozent, zählt sich im Jahr 2025 zu den sogenannten «News-Deprivierten». Diese Personen nutzen kaum oder gar keine Nachrichten, oder wenn, dann hauptsächlich über soziale Medien. Dieser Anteil ist in den letzten Jahren stetig gestiegen, was zu einem besorgniserregenden Informationsdefizit in der Gesellschaft führt.
Wichtige Erkenntnisse
- 46,4% der Schweizer Bevölkerung sind «News-Deprivierte».
- News-Deprivierte haben ein deutlich geringeres Wissen über Politik und Gesellschaft.
- Künstliche Intelligenz nutzt journalistische Inhalte, ohne diese zu vergüten.
- Die Reichweite journalistischer Medien schrumpft weiter, während soziale Medien an Bedeutung gewinnen.
- Die Zahlungsbereitschaft für Online-News steigt leicht, bleibt aber gering.
Informationslücke und ihre Folgen
Die Forschung des Zentrums Öffentlichkeit und Gesellschaft der Universität Zürich (fög) zeigt auf, dass diese Entwicklung gravierende Folgen hat. Basierend auf einer repräsentativen Befragung wurde festgestellt, dass News-Deprivierte ein signifikant geringeres Wissen über politische und gesellschaftliche Themen besitzen. Dies gilt insbesondere für jene, die gänzlich auf Nachrichten verzichten.
Selbst Personen, die sich ausschliesslich über soziale Medien informieren, schneiden im Wissensvergleich schlechter ab als andere Gruppen. «Regelmässiger, aktiver Konsum journalistischer Inhalte über verschiedene Kanäle ist damit entscheidend für die Informiertheit der Bevölkerung», betont Mark Eisenegger, der Direktor des fög.
Wichtige Statistik
Im Jahr 2025 sind 46,4% der Schweizer Bevölkerung «News-Deprivierte», ein Anstieg von 0,7 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr.
Demokratie unter Druck
Die News-Deprivation stellt auch ein fundamentales Problem für die Demokratie dar. Personen, die schlecht informiert sind, vertrauen Politik und Medien weniger. Sie beteiligen sich seltener am politischen Prozess und fühlen sich der demokratischen Gesellschaft weniger verbunden. Eine informierte Bürgerschaft ist jedoch die Grundlage einer funktionierenden Demokratie.
Die Langzeitanalysen des Jahrbuchs bestätigen bestehende Trends: Die publizistische Qualität bleibt zwar stabil, doch langfristig zeigen sich Einbussen bei der Einordnung von Informationen und der geografischen Vielfalt. Gleichzeitig gab es jedoch Verbesserungen bei der Relevanz der Inhalte.
«Eine informierte Bevölkerung braucht professionellen Journalismus.» – Mark Eisenegger, Direktor des fög
Künstliche Intelligenz: Chance und Gefahr
Künstliche Intelligenz (KI) birgt für den Journalismus sowohl Chancen als auch Risiken. Bereits 87 Prozent der Medienschaffenden nutzen KI-Tools, vor allem für unterstützende Aufgaben wie Transkriptionen oder Korrekturen. Doch gleichzeitig droht der Journalismus den direkten Kontakt zum Publikum zu verlieren, wenn Nutzer Informationen zunehmend über KI-Chatbots beziehen.
Es stellt sich die zentrale Frage, welche Rolle journalistische Medien als Quellen in den Antworten von KI-Chatbots spielen. Die Befunde des Jahrbuchs geben hierzu aufschlussreiche Antworten.
Hintergrund: Das fög Jahrbuch
Das Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft (fög) der Universität Zürich veröffentlicht jährlich ein Jahrbuch zur Qualität der Medien. Es analysiert Trends im Medienkonsum, die publizistische Qualität und die Auswirkungen auf die Gesellschaft.
Journalismus als zentrale Quelle für KI-Chatbots
Bei Anfragen, sogenannten Prompts, zu aktuellen Ereignissen erweist sich der Journalismus als der wichtigste Quellentyp für KI-Chatbots. Bei ChatGPT stammen 73,2 Prozent der ausgewiesenen Quellen von journalistischen Medien, bei Perplexity sind es 66,5 Prozent. Internationale Medien machen dabei den grössten Anteil aus.
Bei Fragen mit Bezug zur Schweiz sind hiesige Medien die zentrale Quelle: 36,7 Prozent (ChatGPT) beziehungsweise 47,1 Prozent (Perplexity) der Quellen stammen von Schweizer Medien. Zwei Drittel davon kommen von privaten Medien, ein Drittel von der SRG.
Interessanterweise werden teilweise auch Medien zitiert, die den Zugriff für KI-Chatbots aktiv blockieren. «Damit profitieren KI-Anbieter in hohem Mass von journalistischen Inhalten – ohne dass Medienhäuser eine Entschädigung dafür erhalten», kritisiert Eisenegger.
- ChatGPT: 73,2% der Quellen sind journalistische Medien.
- Perplexity: 66,5% der Quellen sind journalistische Medien.
- Schweiz-Bezug: 36,7% (ChatGPT) bzw. 47,1% (Perplexity) der Quellen stammen von Schweizer Medien.
Finanzielle Herausforderungen und schrumpfende Reichweite
Die finanzielle Lage publizistischer Medien bleibt weiterhin angespannt. Die Werbeumsätze sinken, besonders im Printbereich, während sie online stagnieren. Dies erschwert die Finanzierung qualitativ hochwertigen Journalismus zusätzlich.
Die Reichweite journalistischer Medien schrumpft weiter, während soziale Medien als Hauptinformationsquelle an Bedeutung gewinnen. Dies ist ein gefährlicher Trend, da soziale Medien oft nicht die gleiche Tiefe und Verifikation bieten wie professioneller Journalismus.
Zahlungsbereitschaft für Online-News
Die Zahlungsbereitschaft für Online-News ist im Vergleich zum Vorjahr erstmals seit vier Jahren um 5 Prozentpunkte auf 22,5% gestiegen. Dennoch ist die Mehrheit der Schweizer:innen nicht bereit, dafür zu bezahlen.
Bildung und Schutz des Journalismus sind entscheidend
Eine höhere Nutzung von Nachrichten geht mit politischem Interesse und einer klaren politischen Positionierung einher. Daher sollten Bildungseinrichtungen und die Politik gezielter in politische Bildung und Medienkompetenz investieren.
Gleichzeitig bleibt der Schutz des Journalismus gegenüber kommerziellen KI-Nutzungen zentral. KI-Systeme greifen in grossem Umfang auf journalistische Inhalte zu, ohne dass die Medienhäuser davon profitieren. «Ein besserer Schutz des geistigen Eigentums und eine faire Vergütung des Journalismus sind daher berechtigte Anliegen», so Eisenegger.
Die aktuelle «Opt-out»-Praxis, bei der Medieninhalte für KI-Chatbots blockiert werden, bietet keinen ausreichenden Schutz vor unberechtigtem Zugriff. Es bedarf neuer Lösungen, um die Wertschöpfung des Journalismus in der digitalen Ära zu sichern und die Informationsgrundlage unserer Gesellschaft zu stärken.