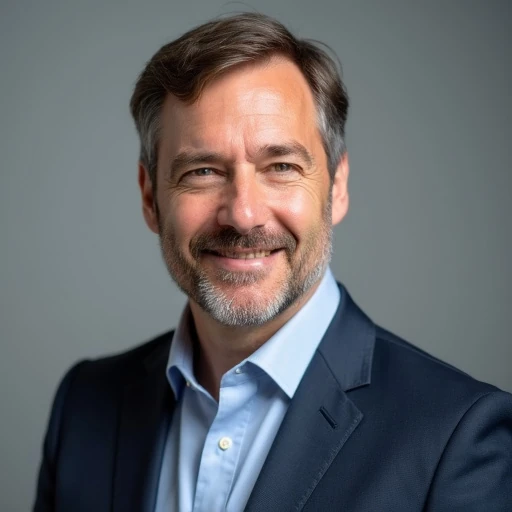Seit einem halben Jahrhundert sorgt der Apron Service am Flughafen Zürich für Ordnung und Sicherheit auf dem Rollfeld. Was am 3. November 1975 als „Ramp Control“ begann, ist heute eine hochmoderne Abteilung, ohne die kein Flugzeug abheben oder andocken könnte. Ein Blick zurück zeigt, wie sich die Arbeit von manueller Planung zu digitaler Präzision entwickelt hat – und warum bei Nebel früher manchmal die Jasskarten gezückt wurden.
Das Wichtigste in Kürze
- Der Apron Service (Vorfeldkontrolle) am Flughafen Zürich feiert sein 50-jähriges Bestehen.
- Die Abteilung nahm am 3. November 1975 unter dem Namen „Ramp Control“ den Betrieb auf.
- Früher fehlte ein Bodenradar, was bei dichtem Nebel den Betrieb lahmlegte und den Controllern Zeit für ein Kartenspiel liess.
- Heute ist die Vorfeldkontrolle ein hochtechnologischer Bereich, der den gesamten Bodenverkehr steuert.
Die Anfänge im Dock B
Als am 3. November 1975 die neu geschaffene Dienststelle „Ramp Control“ im Kontrollturm auf dem Dock B ihre Arbeit aufnahm, war dies ein Meilenstein für den Flughafen Zürich. Erstmals gab es eine zentrale Instanz, die ausschliesslich für die Koordination des Verkehrs auf dem Vorfeld zuständig war. Zuvor war diese Aufgabe weniger strukturiert und wurde von verschiedenen Stellen miterledigt.
Das erste Team war überschaubar und hatte klar definierte Rollen. Es bestand aus einem „Speaker“, der per Funk den Kontakt zu den Piloten hielt, sowie den Positionen „Inbound“, „Outbound“ und „Dispo“. Der Disponent hatte die anspruchsvolle Aufgabe, alle zwei Stunden die Standplätze für die ankommenden und abfliegenden Maschinen manuell zu planen – eine Arbeit, die heute von komplexen Computersystemen unterstützt wird.
Kommunikation über eine einzige Frequenz
Die gesamte Kommunikation lief über die Funkfrequenz 121.75 MHz. Jeder Pilot, der sich auf dem Vorfeld bewegte, musste sich über diesen Kanal mit dem Speaker abstimmen. Erstaunlicherweise ist ein Teil dieser Frequenz auch heute noch in Gebrauch. Südlich der Piste 28 wird heute auf 121.755 MHz gefunkt, was technisch gesehen fast die gleiche Frequenz ist, nur im modernen 8,33-kHz-Raster.
Funkfrequenzen damals und heute
- 1975: 121.75 MHz für das gesamte Vorfeld
- Heute (Süd): 121.755 MHz
- Heute (Nord): 121.855 MHz
Die Aufteilung auf zwei Frequenzen wurde notwendig, um das gestiegene Verkehrsaufkommen effizient zu bewältigen.
Als bei Nebel die Jasskarten gezückt wurden
In den Anfangsjahren war die Vorfeldkontrolle stark von den Wetterbedingungen abhängig. Eine der grössten Herausforderungen war dichter Nebel. Ohne ein Bodenradar, das die Position der Flugzeuge auf dem Rollfeld anzeigt, waren die Controller auf ihre Augen angewiesen. Wenn die Sicht auf null sank, kam der gesamte Bodenverkehr zum Erliegen.
Ehemalige Mitarbeiter erinnern sich in einem Jubiläumsfilm des Flughafens an diese Zeiten. Wenn draussen nichts mehr ging, wurde es im Turm ruhig. So ruhig, dass man Zeit für eine Partie Jass fand, das traditionelle Schweizer Kartenspiel. Diese Anekdote verdeutlicht den enormen technologischen Sprung, den die Luftfahrt in den letzten 50 Jahren gemacht hat.
Die Bedeutung des Bodenradars
Ein Bodenradar (Surface Movement Radar) ist ein spezielles Radarsystem, das den Fluglotsen eine exakte Darstellung aller Fahrzeuge und Flugzeuge auf den Rollwegen und Pisten liefert. Es ist unerlässlich für den sicheren Betrieb bei schlechter Sicht, wie bei Nacht, starkem Regen oder Nebel. Die Einführung dieser Technologie hat die Kapazität und Sicherheit von Flughäfen weltweit revolutioniert.
Heute ist ein Betrieb ohne technische Hilfsmittel undenkbar. Moderne Systeme ermöglichen es den Controllern, jedes Flugzeug millimetergenau auf ihren Bildschirmen zu verfolgen, unabhängig von der Sicht. Die Sicherheit hat sich dadurch massiv erhöht, und wetterbedingte Stillstände auf dem Vorfeld sind extrem selten geworden.
Die moderne Vorfeldkontrolle
Der Name hat sich von „Ramp Control“ zu „Apron Control“ oder „Vorfeldkontrolle“ geändert, doch die Kernaufgabe ist dieselbe geblieben: die sichere und effiziente Steuerung aller Bewegungen auf dem Vorfeld. Das Aufgabenspektrum hat sich jedoch erheblich erweitert.
Die heutigen Apron Controller sind für weit mehr als nur die Zuweisung von Standplätzen zuständig. Sie koordinieren:
- Pushbacks: Das Zurückstossen der Flugzeuge vom Gate.
- Schleppvorgänge: Das Ziehen von Flugzeugen zu Wartungspositionen oder Enteisungsflächen.
- Rollverkehr: Die Führung der Flugzeuge vom Gate zur Startbahn und von der Landebahn zum Gate.
- Fahrzeugverkehr: Die Koordination von unzähligen Servicefahrzeugen wie Tankwagen, Gepäcktransportern und Catering-LKW.
Ein hochkomplexes Zusammenspiel
Ein moderner Grossflughafen wie Zürich ist eine Stadt in der Stadt. Tausende von Bewegungen müssen pro Tag präzise aufeinander abgestimmt werden. Ein kleiner Fehler oder eine Verzögerung kann einen Dominoeffekt auslösen, der den gesamten Flugplan durcheinanderbringt.
Die Controller arbeiten heute mit hochentwickelten Softwarelösungen, die ihnen bei der Planung und Überwachung helfen. Dennoch bleibt der menschliche Faktor entscheidend. Es braucht Konzentration, Erfahrung und die Fähigkeit, unter Druck schnelle und richtige Entscheidungen zu treffen. Wie es der Flughafen Zürich formuliert: Ohne Apron Control bewegt sich hier nichts.
Blick in die Zukunft
Die Digitalisierung und Automatisierung werden die Arbeit der Vorfeldkontrolle auch in Zukunft weiter verändern. Konzepte wie ferngesteuerte Schleppfahrzeuge oder eine noch stärkere Vernetzung aller am Prozess beteiligten Akteure sind bereits in der Entwicklung. Das Ziel bleibt jedoch dasselbe wie vor 50 Jahren: einen reibungslosen, sicheren und pünktlichen Flugbetrieb zu gewährleisten.
Das 50-jährige Jubiläum ist nicht nur ein Rückblick auf eine erfolgreiche Geschichte, sondern auch ein Zeugnis für die Anpassungsfähigkeit und Professionalität der Menschen, die im Verborgenen dafür sorgen, dass Millionen von Passagieren jedes Jahr sicher reisen können. Die Zeiten des Jassens bei Nebel sind vorbei, doch der Geist der Präzision und Verantwortung lebt im Turm über dem Dock B weiter.